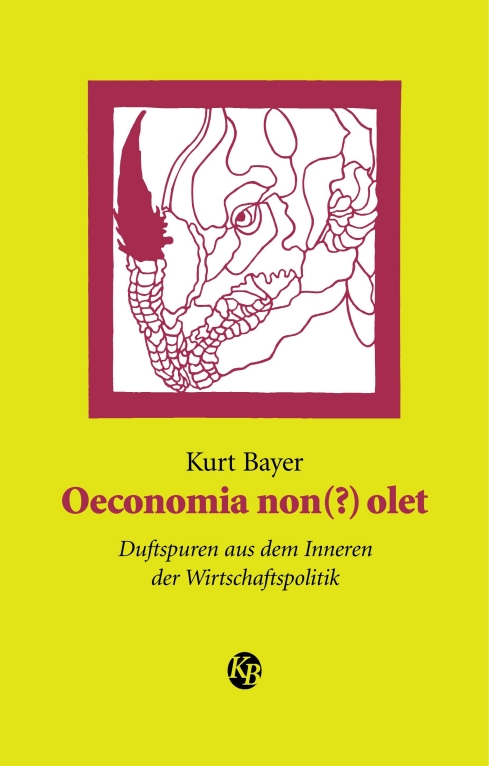Ceterum censit Lingens: Saldenmechanik
Wolfgang Försters Leserbrief (Falter 18/24), dass Lingens „gefühlte 100 Wiederholungen, (dass) Deutschlands Lohnzurückhaltung“ die Wurzel alles Übels Europas sei, trifft den Punkt genau. Und, wie das Amen im Gebet, ist das schon wieder Lingens’ Credo in der letzten Kolumne „Die Zählebigkeit ökonomischer Irrtümer“ (Falter 18/24), wo er sich als Watschenmann den Harvard-Ökonomen Kenneth Rogoff herholt, der dafür verantwortlich wäre, dass die EU Wachstum eingebüßt hätte. Also: Rogoff hat zusammen mit der ebenfalls renommierten Ökonomin Carmen Reinhard im Zuge der Welt-Finanzkrise nach 2008 im New York Times Besteller „This Time is Different. Eight Centuries of Financial Folly“ (Princeton University Press 2009) nach einer gründlichen Untersuchung von 200 Jahren Schuldenkrisen über viele Länder festgestellt, dass – ebenso wie in der Finanzkrise 2008 ff.- die Wirtschaftspolitik jedes Mal meine, dass die aktuelle Krise „anders“ als alle vorigen sei, und daher jetzt besser bewältigt und künftige verhindert werden könnten. Der Autoren Fazit ist, dass man sehr wohl aus „alten“ Krisen lernen könne, dass das Finanzsystem, trotz immer neuer und anderer, manchmal weniger, Regulierungen weiterhin sehr fragil sei, dass also solche Krisen immer wieder drohen würden. Mithilfe einer empirischen Zusatz-Analyse, die als mit einem Fehler behaftet kritisiert wurde, stellen sie fest, dass eine Staatsverschuldung von mehr als 90% des BIP über den gesamten Zeitraum und die analysierten Länder hinweg die Wahrscheinlichkeit einer Finanzkrise erhöht hätte. Rogoff-Reinhart haben den Fehler in einer Excel-Tabelle zugegeben, haben jedoch – unwidersprochen gemeint – dass zwar die 90%-Schwelle nicht zu halten sei, aber die grundsätzliche Schlußfolgerung weiter aufrecht bleibe: hohe Staatsverschuldung erhöhe die Krisenwahrscheinlichkeit, der Finanzsektor nütze die Anreize, dass die Wirtschaftspolitik beim Fallen von Vermögenspreisen gegensteuere, dies aber bei Steigen der Preise nicht täte, zu erhöhter Risikobereitschaft und bleibe daher fragil. Einige (berechtigte) Kritiker der 90%-Schwelle zitiert Lingens zustimmend für seine immer wieder wiederholte These, dass Rogoff damit für die deutsche Austeritätspolitik verantwortlich sei und bringt als „Gegenbeispiel“ für die Sinnlosigkeit der Rogoff-Reinhart-Analyse die hohe Verschuldung der USA, die totzdem stark gewachsen seien.
Rogoff-Reinharts Studie (463 Seiten!) befaßt sich, im Gegensatz zu Lingens’ Meinung, nicht mit der konjunkturellen Erhöhung von Staatsverschuldung, sondern mit den dadurch ausgelösten „Asset Bubbles“, mit interner versus externer Verschuldung, mit Wechselkurs- und Bankenkrisen, mit den Entstehungsgründen und dem Verlauf von Finanzkrisen, mit wirtschaftspolitischen Gegensteuerungsmaßnahmen, und vielem anderen mehr. Zielaussage der Studie ist die Fragilität des Finanzsystems über die Jahrhunderte und die Kurzsichtigkeit und Planlosigkeit der Wirtschaftspolitik, die daraus nichts lernen will. Diese Studie – so kritikwürdig sie in vieler Hinsicht sein mag – für die deutsche Austeritätspolitik, die Griechenlandkrise und die Wachstumsschwäche Europas verantwortlich zu machen, ist einfach unseriös.
Lingens spannt dann den Bogen zum nunmehr neu formulierten Stabilitäts- und Wachstumspakt, den er zurecht kritisiert, um dann wieder auf seine „Ökonomie-Weltformel Saldenmechanik“ als Erlöser zu kommen, die als einzige „ein gültiges ökonomisches Gesetz“ formuliere. Er spielt damit auf die makroökonomische Gleichung an, nach der alle Ausgaben einer Volkswirtschaft deren Einnahmen enstprechen müssen. Ja, das stimmt natürlich, aber es ist eben eine Bilanzgleichung, die die Beweggründe für die Verhalten der einzelnen Akteure und deren Auswirkungen auf die einzelnen Aggregate außer Acht läßt, was die Aufgabe ökonomischer Theorien ist. Zurecht meint Lingens, dass die Steigerung der Budgetdefizite in der Krise durch die Zurückhaltung der Konsumenten und Investoren zwangsläufig gewesen sei (er läßt dabei das neben Konsum, Investitionen und Staatsverschuuldung vierte wesenltiche Aggregat der Nachfrage, nämlich Nettoexporte aus), er „vergißt“ aber die säkuläre Steigerung der Schuldenquoten, die eben nicht nur auf die notwendige kurzfristige Stabilisierung der Gesamtnachfrage zurückgehen, sondern in der Macht der Finanzmärkte, „ihre Geschäftsmodelle und Gewinne“ zu stabilisieren bzw. zu erhöhen, sowie den asymmetrischen Politikantworten liegen. Er hat recht, wenn der die Staatsschuldenbremse Deutschlands und die Versessenheit der EU, öffentliche Haushalte zu „konsolidieren“ als gegenproduktiv in der Krise anprangert. Er macht es sich jedoch zu leicht, mit dem Schlegel „Saldenmechanik“ alle komplexen Vorgänge der Ökonomie erklären zu wollen. Und er tut Rogoff (der beileibe kein Ökonomie-Engel ist) Unrecht, wenn er ihn kurzerhand zum Meister der Budgetkonsolidierung und Veranwortlichen der EU-Wachstumsschwäche erklärt.