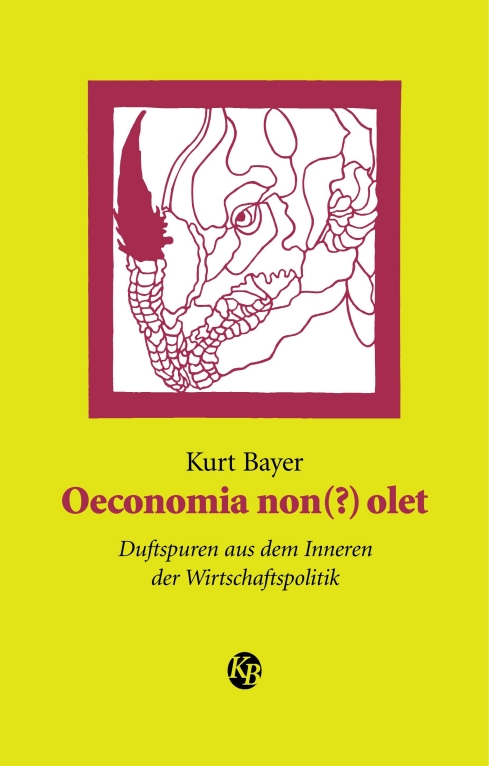Die anstehenden Europawahlen, ein neues Parlament, eine neue EU-Kommission, vielfältige Mid-Term Reviews, die Neuorientierung des EU Budgetrahmens – all dies suggeriert einen notwendigen Neustart für die Wirtschaftspolitik. Die politische Realität sieht allerdings anders aus, verspricht – in den Wahlprogrammen der Fraktionen – bestenfalls „mehr und besseres vom Alten“. Im folgenden werden einige Grundsätze formuliert, die für einen tatsächlichen Neubeginn, der den viel beschworenen Herausforderungen der Zukunft gerecht(er) werden, notwendig sind. Auf die (entscheidend) wichtige Frage, ob und wie sie politisch durchsetzbar sind, wird verzichtet. Es handelt sich daher um die viel beschworenen „Wünsche ans Christkind“, bzw. an die EU-Wählerschaft.
1. Grundlage muss die Einsicht sein, dass die bisher verfolgte Wirtschaftspolitik, sei sie als „neoliberal“ oder anders markiert, neben Erfolgen uns jene Probleme eingebrockt hat, vor denen wir jetzt existenziell stehen: die Klima- und Biodiversitätskrise, die soziale Krise durch immer weiteres Auseinanderklaffen von Einkommen und Vermögen, die politische Krise, die den sozialen Zusammenhalt auflöst. Ein Weitermachen wie bisher, trotz eines „Drehens an kleinen Schrauben“, wird Wirtschaft und Gesellschaft an die Wand der planetaren Grenzen und der autoritären Vereinfacher fahren lassen.
2. Dazu gehört die Einsicht, dass die massive Expansion des Finanzsektors (er ist mehr als viermal so groß wie die Weltwirtschaft), der zunehmend die Wirtschaftspolitik mit seinen Interessen dominiert, die Wirtschaft destabilisiert, die Langfristigkeit von Investitionsentscheidungen einschränkt und die Profitinteressen der Finanzmarktakteure und Multinationalen Unternehmen über die Interessen der Bevölkerung an einem „guten Leben“ stellt. Eine Einschränkung des Finanzsektors, eine Rückführung auf seine notwendige und ursprüngliche Funktion, Wirtschaft und Gesellschaft zu finanzieren anstatt durch Sekundenhandel auch die kleinsten Bewertungsunterschiede zum Renditemachen zu nutzen und über Greenwashing weiterhin massiv fossile Porojekte zu finanzieren, ist absolut notwendig. Die von vielen beschworene „Vollendung der Kapitalmarktunion“ würde der weiteren Expansion des Finanzsektors dienen. Statt dessen sollte man sich auf die „ Vollendung der Bankenunion“ konzentrieren, da in den Banken eine direkte Beziehung zwischen Investor und Finanzer besteht anstatt diese einen anonymen „Markt“ zu überlassen und im Bankenbereich bereits funktionierende Institutionen (gemeinsame Aufsicht) bestehen.
3. Die von Enrico Letta geleitete Bewertung des EU-Binnenmarktes schlägt zwar positiv die Europäisierung der Bahn- und Kommunikations- und Energienetzwerke vor, sowie die Schaffung einer „Fünften Freiheit“, nämlich im Forschungs- und Ausbildungsbereich, bleibt aber sonst dem alten Dogma verhaftet, dass die im Binnenmarkt angelegte „Globaliserung auf Steroiden“ zum Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit der EU-Wirtschaft gegenüber dem Ausland weiter getrieben werden sollte. Statt dessen sollte der Binnenmarkt – als Kernstück der EU-Struktur, bzw. Angebotspolitik – zum Treiber der notwendigen klima- und sozialbedingten Nachhaltigkeit gemacht werden. Dies würde aber auch bedeuten, die „heiligen“ vier Freiheiten des Binnenmarktes, nämlich jene des Güter- und Dienstleistungsverkehrs, des Kapitalverkehrs und des Personenverkehrs, zu überdenken und dort zugunsten der zu erzielenden Nachhaltigkeit einzuschränken, wo dies notwendig ist. Wir sehen heute, dass die Personenfreizügigkeit in vielen neuen EU-Ländern zu massiver Abwanderung geführt hat, dass die Güter- und Dienstleistungsfreiheit die ungleichen Ausgangsbedingungen schwächerer Länder zu deren Lasten ignoriert hat, dass die Kapitalverkehrsfreiheit nicht zu gleicheren Finanzierungsbedingungen, sondern zur weiteren Konzentration finanzieller und wirtschaftlicher Macht geführt und Umwelt- und Sozialkrise verstärkt hat.
4. Bisher ignoriert die EU-Wirtschaftspolitik ihren eigenen Binnenmarkt, also das eigene Territorium mit 450 Millionen Einwohnern, als Ziel ihrer Makropolitik: die Fiskalpolitik „gehört“ den Mitgliedstaaten und wird von der Kommission länderweise überwacht. Ziel der Fiskalpolitik der Euroraumes ist nicht die Gesamtheit der Eurozone, wie sie durch die gemeinsame Geldpolitik der Europäischen Zentralbank auf der Geldseite angepeilt wird, sondern jedes einzelne Land. Statt dessen sollte die gemeinsame Fiskalpolitik des Euroraumes mit der gemeinsamen Geldpolitik abgestimmt werden („Makroökonomischer Policymix“) und erst dann auf die einzelnen Länder heruntergebrochen werden. Derzeit wedelt der Schwanz – die Empfehlungen für jedes einzelne Euroland – mit dem Hund Eurozone. Die Ergebnisse sind entsprechend. Der auch in seiner erneuerten Form gegenproduktive Stabilitäts- und Wachstumspakt verhindert eine die Nachhaltigkeit forcierende Fiskalpolitik. Es braucht die Einrichtung einer gemeinsamen Euro-Fiskalbehörde, eines eigenen Budgets mit Ausrichtung auf die Nachhaltigkeit.
Ziel der gemeinsamen Makropolitik sollte die Steigerung des Wohlergehens der BürgerInnen der Eurozone, der EU, sein und nicht die „Wettbewerbsfähigkeit nach außen“. Es kann und soll nicht das Ziel der EU sein, Leistungsbilanzüberschüsse gegenüber dem „Rest“ der Welt zu lukrieren, sondern „gutes Leben“ für alle in der EU zu gewährleisten. Dies hätte positive Folgen für die Lohnpolitik der EU, da dann Lohnkosten nicht überwiegend als negativer, d.h. zu drückender, Kostenfaktor gesehen würden, sondern als positiv zu bewertender Nachfragefaktor.
5. Eine wirksame Klima- und Umweltpolitik muss sich sowohl auf die Produktionsseite (Industrie inklusive Dienstleistungen, Verkehr, Bau) wie auf die Konsumseite beziehen. Daten zeigen, dass die Emissionen der Konsumseite um etwa 10% höher liegen als jene der Produktionsseite, da viele konsumierte und investierte emissionsintensive Güter importiert werden. Daher sind Beschränkungen auch des Konsums in Betracht zu ziehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass „Konsum“ und Bedürfnisbefriedigung nicht „gottgegeben“ sind, sondern durch eine ausufernde Werbeindustrie im Interesse der Produzenten und Händler generiert werden. Dass Konsumbeschränkungen, durch Regulierung oder Steuern, in Österreich eine lange Geschichte haben, zeigt die 1975 eingeführte „Luxussteuer“ (erhöhter Mehrwertsteuersatz) auf große Autos und anderen „Luxuskonsum“. Auch die niedrigeren Steuersätze für Güter des Grundbedarfs sind üblich. Beschränkungen des Alkohol- und Tabakkonsums oder Gurten- und Helmpflicht sind regulatorische Beispiele. Breite gesellschaftliche Diskussion von Konsumbeschränkungen ist nötig.
6. Die Ausrichtung der Wirtschaftspolitik auf das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) als Indikator für gesellschaftlichen Wohlstand gehört schleunigst geändert. Viele Diskussionen und Studien zeigen, dass das materielle BIP zwar wichtiger Teil des Wohlstandes ist, aber nicht ausreicht: die Qualität der Umwelt, der Gesundheitsversorgung, der Armutsbekämpfung, der persönlichen Sicherheit, der Freizeitmöglichkeiten, der sozialen Einbindung und anderes spielen eine ebenso große Rolle. Ein breiterer Wohsltandsindikator sollte das BIP als primäres Ziel ablösen. Dabei würde klar, dass ein großer Teil des BIP nicht wohlstandsfördernd ist, sondern primär getätigt wird (werden muss), um die Negativa der BIP-Produktion und des Konsums auszugleichen: längere Anfahrtszeiten zwischen Wohnort und Beruf, die Reparaturkosten von Umweltschäden (Überschwemmungen, Dürren, Lawinen, Waldbrände) und privatem Verhalten (Autounfälle), mehr Sicherheitsvorrichtungen – all diese und viele andere erhöhen zwar das BIP, jedoch nicht den Wohlstand der Bevölkerung; eklatantestes Beispiel ist die Waffenproduktion, die das BIP erhöht aber wenn eingesetzt, durch Schäden an Personen und Gütern massiv wohlstandsreduzierend wirkt.
7. Eine neue Wirtschaftspolitik betrifft nicht nur die “Wirtschaft“ im engeren Sinn, sondern muss übergreifend für Soziales und Umwelt mitgestaltet werden. Umweltprobleme und soziale Probleme sind dann nicht mehr – wie von der herrschenden Wirtschaftsdogmatik gesehen – „externe Effekte“, oder „Kollateralschäden“ der Wirtschaftspolitik im engeren Sinne, sondern essenzielle Bestandteile einer sektorübergreifenden Politik. Jeder wirtschaftspolitische Eingriff muss daher, neben Unternehmens-, Arbeitsplatz- und Inflationsauswirkungen auf seine umwelt- und sozialrelevanten Auswirkungen überprüft, Tradeoffs erkannt und gelöst und gesamthaft in dem Sinne gedacht werden, ob damit die im „offiziellen“ Wohlstandsindikator gebündelten Ziele erreicht werden. Dabei wird klar, dass es in vielen Bereichen keine „eindeutigen“ Lösungen gibt, dass Kompromisse angestrebt werden müssen, dass die „Objekte“ einer breit gedachten Wirtschaftspolitik sehr unterschiedliche Interessenlagen haben und Lösungen benötigt werden, die für alle, bzw. die meisten, „akzeptabel“, wenn schon nicht „optimal“ sind.
8. Trotz hier geforderter Konzentration auf den eigenen Binnenmarkt muss eine EU-Wirtschaftspolitik auch auf die neuen geopolitischen Entwicklungen, auf ihre Rolle in der Welt Rücksicht nehmen, allerdings nicht in der Weise, sich in den Hegemonialstreit USA-China einzumischen oder gar Partei zu ergreifen, sondern sich so auszurichten, dass es der Steigerung der Wohlfahrt der eigenen Bevölkerung dient. Auch wenn sich die EU der „regelbasierten liberalen Weltordnung“, die von den USA seit Ende des 2. Weltkriegs dominiert wurde, inhaltlich zugehörig fühlt, muss sie sich an den neuen, noch im Fluß befindlichen Entwicklungen, orientieren, die in Richtung einer Multipolarität gehen. Dies bedeutet konkret, in den globalen Institutionen, wie IMF und Weltbank, ihre eigenen der Wirtschaftsleistung nicht mehr entsprechenden Positionen zugunsten aufstrebender und Entwicklungsländer zu reduzieren, um diese Institutionen tatsächlich zu Weltinstitutionen zu machen. Das Entstehen neuer, konkurrierender Institutionen, wie jene der BRICS-Länder, aber auch andere, zeigen, dass die mangelnde Mitsprache des “Globalen Südens“ in den Bretton Woods Institutionen zu einer Fragmentierung der möglichen globalen Steuerung geführt haben. Kühne Vorhaben, wie etwa der brasilianische G-20 Vorstoß zur Einführung einer 2%-igen Vermögensteuer auf Superreiche deuten auch auf ein Erstarken der Stimmen der Marginalisierten Länder im der Global Governance hin.
9. Die EU muß nicht – wie mehrfach gefordert – nachahmenswertes „Vorbild“ für andere Länder werden. Sie kann aber, vor allem im Regulierungsbereich, wie sehr effektiv mit der Datenschutz-Grundverordnung gezeigt, internationale Maßstäbe sezten, an denen sich andere orientieren. Sie kann, wie der Green Deal zeigt, wie die Einführung von CO2-Bepreisung zeigt, wie das Instrument des CBAM (Umwelt-Ausgleichstarif bei Einfuhren) zeigt, andere Länder auffordern, ähnliche Steuerungselemente im Umwelt- und Sozialbereich einzuführen wie in der EU selbst. Voraussetzung für eine wichtige Rolle in der globalen Steuerung ist aber immer, innerhalb der EU selbst zu wirksamen Lösungen zu kommen.
10. In seiner „Rede an Europa“ am 7.5.2024 am Judenplatz hat Omri Boehm eingangs die zivilisatorisch einmalige Leistung der Souveränitätsaufgabe der EU-Länder gewürdigt. Diese grundlegende Leistung der 6 Gründungsstaaten wird heute kaum noch erwähnt, höchstens im negativenn Sinn, wenn etwa neue EU-Institutionen oder gemeinsame Finanzierung gefordert wird. Natürlich benötigt eine Neuaufstellung der EU-Politik auch eine Neuordnung der internen Verfahren, die klarere Verantwortlichkeiten, raschere Entscheidungen und viel stärkere Einbindung der Bevölkerung enthalten. Das alles bedeutet mehr Übertragung von Souveränität an die gemeinsamen Institutionen.
Die EU-Wahlprogramme der österreichischen Parteien äußern sich kaum zu diesen grundlegenden Fragen, etwas mehr tun dies, wenn auch nicht ausreichend, die “Spitzenkandidaten” der EU-Frkationen. Sie fordern – unterschiedlich – einzelne Verbesserungen innerhalb des bestehenden Systems. Nur die FPÖ und die anderen radikalen Rechtsparteien zeigen ihre grundsätzliche Verachtung gegenüber diesem zivilisatorischen Fortschritt.
Die EU-Feindlichkeit der Rechtspopulisten, die mehr Eigensouveränität propagieren und damit in die dunkle Geschichte zurück wollen, gewinnt angesichts der Unfähigkeit der EU-Institutionen, unserer Regierungen, diese Leistung und ihre Auswirkungen immer wieder zu würdigen, immer mehr an Popularität. Die Gefangennahme der Medien durch ihre „sozialen“ Brüder und die Interessen von finanzgetriebenen Oligarchen tut dazu das Ihrige. Dem müssen wir eine Vision für ein „besseres Leben“ in Gemeinsamkeit – trotz aller Unterschiedlichkeiten – entgegenstellen. Nur so können die Bevölkerungen überzeugt werden, dass eigenstaatliche Souverändität in Zeiten globaler Bedrohungen, in Zeiten einer grundlegend verfehlten Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik nicht ausreichebn kann, um die Umwelt- und Sozial- und Machtprobleme, die uns tägleich vor Augen geführt werden, zu bewältigen. Wir müssen „Europa“ wieder neu denken: die Zeiten haben sich seit den „Gründervätern“ massiv verändert. Die Erfolge der Vergangenheit haben sich zum Teil in Bedrohungen verwandelt: diesen müssen wir begegnen, damit wir und die nachfolgenden Generationen ein besseres, aber anderes, Leben haben können.