(mit diesem Eintrag beginne ich eine neue Staffel über Kulturereignisse. Interessierte LeserInnen seien erinnert, dass ich neue Einträge in den nächsten Monaten immer diesem Blog (5.2.24) am Anfang hinzufügen werde, also nicht jedesmal ein neuer Blog angesprochen wird).
„White Trash. The 400-Year Untold History of Class in America. Penguin, Random House, 2017“ ist mehr als ein Augenöffner. Nancy Isenberg, die Autorin, beschreibt in genauestem Detail Geschichte und Persistenz der meist verschwiegenen Armut und Klassengesellschaft in den USA. Ausgehend von den frühen Ansiedlungen, die von unerwünschten Elementen der englsichen Gesellschaft bevölkert wurden, die man von dort loswerden wollte (viele Gefangene und Ansässige von Armen- und Arbeitshäusern wurden auch nach Australien verschickt), bildete sich in den Südstaaten der USA eine landlose Arbeiterschicht, die zunehmend von den importierten afrikanischen Sklaven verdrängt wurde und weitgehend verelendete. Die Sklaven waren angeblich unterwürfiger, arbeitsamer und billiger. Die Gebärfähigkeit der Sklavinnen wurde als Kapital, als Investition der Pflanzer gefördert, je mehr Sklaven, desto mehr Land konnte in Baumwollplantagen verwandelt worden und förderte damit Landbesitz, der auch Wahlrecht ermöglichte, und Reichtum. Das weiße Proletariat wurde in schlechte Böden abgedrängt, in die Armut, die zunehmend als genetisch bedingt, als unausweichlich angesehen wurde. Eugenische Gedanken und Politik förderten – ausgehend von den Gedanken der Tierzucht – „gutes Blut“ und betrachtete die Armen als genuin faul, unfähig zur Arbeit, als entbehrlich („waste people“), die niemand wollte. Der Bürgerkrieg versuchte in den Südstaaten, die Armen als Kanonenfutter zu mißbrauchen, deren massenhafte Flucht in die Sümpfe der Carolinas, Georgiens wurde als weiterer Beweis, dass sie minderweitig seien gesehen. Die frühen Revolutionäre und Gründerväter revoltierten zwar gegen die britische Krone und Feudalwirtschaft, errichtete jedoch ebenso eine Landaristokratie in den USA, wo durch eine Polltax, Wahlberechtigung mit Landbesitz verbunden war. Die Rückständigkeit der Südstaaten, das Insistieren auf der Baumwoll- und Tabakwirtschaft, wurde im Norden belächelt. Auch das Narrativ des Aufbruchs in den Westen mit Planwagen, die angeblich Aufstieg durch Arbeit linderten, wird von Isenberg als Schimäre entlarvt, da sehr bald die Spekulanten und Investoren das beste Land für sich und ihre Klientel buchten und die ersten Siedler in drittklassige Böden abschoben. Die kulturelle Hegemonie des Nordens und später Westens perpetuierte die stagnierende Klassengesellschaft; die ersten Südstaaten-Präsidenten wurden von den Nordeliten als Trottel, Bauerntölpel und jedenfalls ungeeignet für das Präsidentenamt bezeichnet. Dies gilt auch für Jimmy Carter, Bill Clinton, die immer als Südstaatenboys – trotz ihrer hervorragenden Ausbildung – verunglimpft wurden.
Die Versuche der Roosevelts, vor allem die groß angelegten Infrastrukturprojekte im Süden (Tennessee Valley Authority) brachten zwar Facharbeiterjobs in den Süden, doch auch eine Reihe von Mustersiedlungen der Regierungen (mit Schulen, Krankenhäusern) konnten das generelle Los der Rückständigkeit der Südstaaten, und der damit verbundenen eklatanten Armut, die sich in Wohnwagenseidlungen (bis heute) äußern, die niemand als „Heim“ bezeichnet, nicht lindern. Der Zuchtgedanke, die „fitten Familien“ der Oberklasse relegierte die Armen zur dauernden Unterschicht, die mit einer Vielzahl von abwertenden Begriffen (weißer Abschaum, Cracker, Rednecks und vielen mehr) bedacht wurde und jedenfalls von der Ideologie des „amerikanischen Traums“, der Möglichkeit des sozialen Aufstiegs, bis heute weitgehend ausgeschlossen blieb.
Es lohnt sich, diese soziale Abwertung, das Abschieben, das Nicht-Wissen-Wollen bei Isenberg nachzulesen. Ihr Buch beschreibt zwar weniger die realen Lebensverhältnisse des „Abschaums“ als die Meinung der anderen über diese Unterschichten, belegt dies aber minuziös mit einer Vielzahl von Literaturzitaten und auch Bildern. Sie beschreibt den unwahrscheinlichen Aufstieg des Elvis Presley als Sohl ärmster Farmarbeiter bis hin zu seinen neureichen Reichtumsanhäfungen („Graceland“), dessen Popularität sich Lyndon Johnson (Texaner) ebenso zunutze machte wie Bill Clinton (Arkansas).
Relativ wenig befaßt sich Isenberg mit der schwarzen Unterschicht; was vollkommen fehlt, ist die Frage der ethnischen Herkunft des „Abschaums“, der Immigration aus ganz Europa und Asien. Liest man das Buch, geht es nur um die Britishness. Dabei könnte man annehmen, dass unterschiedliche Immigrationswellen unterschiedliche Klassenstrukturen hervorgebracht haben.
Isenberg weist nach, dass die Klassenstrukturen in den USA festgemauert sind, anhand der höheren Sozialausgaben in Europa meint sie zu erkennen, dass deren Fehlen, bzw. die Widerstände gegen Johnsons (Great Society), Carters und Obamas (Krankenversicherung) Sozialreformen die Ignoranz gegenüber den Armen, bzw. die „feste Ordnung“ erkennen ließen. Erst das Elend der Großen Depression, als ein Viertel der Amerikaner ihren Arbeitsplatz verloren, hätte das Verständnis der Mittelklassen, dass Mobilität in beide Richtungen gehen kann, etwas erhöht. Dennoch geißelt sie die Macht der 1% heute, deren Besteuerung 2009 5.2% ihrer Einkommen ausmachte, während die untersten 20% 11% Steuerleistung erbrächten. (Eine kürzliche Oxfam Studie berichtet, dass die 3000 Milliardäre nur 0.5% Steuern zahlen, siehe meinen Blogpost vom 25.4.2024).
Die große Betonung, die Isenberg auf das eugenische „Breeding“ (die Bedeutung „guten Blutes“, also der Herkunft) als essenzieller Bestandteil der Klassenverfestigung legt – sie weist zB auf die Wahlkämpfe Mitt Romneys hin, aber auch die zahlreiche Mitglieder umfassende Kennedyfamilie – bezeichnet sie neben der Grundlage der sozialen Stratifizierung als große Ironie gegenüber den europäischen dynastischen Verhältnissen, aus denen sich die Gründer befreien wollten.
Es gelingt Isenberg hervorragend, den Unterschied zwischen Ideologie – USA als d e r Hort des Aufstiegs – und den Realität der riesigen gefangenen Unterschicht darzulegen. Für jemanden wie mich, der sich als halbwegs Kenner der USA gesehen hat, ein wirklicher Augenöffner.
Molières “Der Menschenfeind” (von 1667) am Burgtheater in der Regie Martin Kusejs bezeugt, dass ein schwaches Stück über den Gegesatz der Moral des Einzelnen mit jenem der Gesellschaft weit über das 17. Jahrhundert hinaus Gültigkeit hat. Es geht um die Zerrissenheit des jungen Adeligen Alceste (Itan Iray), der Freunde und Gesellschaft geisselt, weil ihre Anpassungsfähigkeit an die jeweils anderen seiner eigenen Kompromißlosigkeit widerspricht. Brüchig wird es, als er seiner Geliebten (Mavie Hörbiger) zwar mit leidenschaftlicher Eifersucht begegnet, ihr aber letztlich seine Liebe nicht wirklich gestehen kann, vielleicht weil er ihren Lebenswandel mißbilligt. In einem aufgetauchten Brief, in welchem sie sich über alle ihre Liebhaber lustig macht, bleibt er als einziger ihr treu, weigert sich aber, sich von ihr “bei Hof” helfen zu lassen, da er einen Prozeß gegen einen dichterischen Höfling, dessen Werk er verrisen hat, verliert. Verdrossen von dieser Welt, will er sich mit ihr auf ein Landgut zurückziehen, “weg aus dieser Welt”, was sie ihm wegen der dort drohenden Einsamkeit, “nur wir zwei allein”, verweigert.
Es ist ein Konversationsstück zwischen hauptsächlich drei Personen, bei dem sich wenig tut. Kusejs kluge Inszenierung läß0t das Ganze auf einem brüchigen Brettrerboden mit Wasserlacken spielen, spiegelt genial Zuschauerraum des Theaters und Scharen von tanzenden Menschen im Hintergrund und bringt so dem Stück Dynamik bei. Große SchauspielerInnen-Leistungen, wie erwartet machen dennoch die Schwächen des Stückes nicht wett.
Kapitalismus am Limit von Ulrich Brand und Markus Wissen (oekom 2024) ist eine Vertiefung und Fortsetzung ihres Bestsellers “Imperiale Lebensweise” von 2017. Hier jetzt geht es um die “Öko-Imperiale(n) Spannungen, umkämpfte Krisenpolitik und solidarische Perspektiven”. B-W legen in sehr lesbaerer Weise (nur Text, keine Tabellen und Grafiken, alle sehr vielen Fußnoten im Anhang) dar, wie die kapitalistische (also unsere) Produktions- und Konsumweise Mensch und Unternehmen durch Ausbeutung der Arbeitskraft (nicht neu), Ausbeutung der Natur und Ausbeutung des Globalen Südens uns (nicht allen) im Norden durch Überschreitung sozialer, politischer und planetarer Grenzen einen hohen Lebensstandard ermöglicht hat, der aufgrund dieser Grenzen nicht global erreichbar ist. Primär bezieht sich der Band auf die Ausbeutung und Übernutzung der Natur, sichtbar im fossilen Zeitalter, welches auch andere Bodenschätze mit einschließt. Überzeugend legen sie dar, dass “grüne” reformatorische Ansätze, etwa die Umstellung der Automobilität auf elektrische Antriebe das kapitalistische System weiter an die Wand fahren läßt, schon deshalb, weil der Wechsel von fossilen zu elektrischen Antrieben viele andere Rohstoffe – auch endlich – benötigt. Im letzten Kapitel zeichnen sie “solidarische” Strategien auf, die eine Überwindung des Kapitalismus möglich scheinen lassen. Realistischerweise sehen sie den derzeitigen “Staat” zwar durch die fossilen Kapitalinteressen gegängelt, weisen aber darauf hin, dass es den Staat, die Gesellschaft und deren mächtige Apparate brauchen wird, um zu dieser solidarischen Gesellschaft und Wirtschaft zu kommen. Die wohlgemeinten Einzelinitiativen werden ohne staatliche Leitung nicht die Mobilität auf Öffis bewirken, nicht den Über- und Luxuskonsum mit seinen schädlichen Folgen eindämmen und nicht die Nahrungsaufnahme weg vom Land- und Umwelt-intensiven Fleischverzehr schaffen. B_W kennen die politischen Verfahren gut genug, um in naive “Wünsche ans Christkind” zu verfallen: genau sehen sie die Attraktivität der herrschenden Konsum- und Produktionsweise für Haushalte und Unternehmer, deren Präferenzen seit Jahrzehnten geprägt und durch Reklame verstärkt wurden. Dennoch bleibt mehr als ein Hoffnungsschimmer, der durch “subversive” Zellen im Staatsapparat, durch viele Initiativen der Zivilgesellschaft und Teile der Wissenschaft genährt wird.
Der Film “One Life” with Anthony Hopkins über die von einem britischen Börsenmakler organisierten Kindertransporte aus Prag trieb mir mehrmals die Tränen aus den Augen. Während meiner Zeit in London arbeitete ich ganz nahe bei der Liverpoolstreet Station, in der eine Skulptur mit zwei Kindern mit Koffern als Erinnerung an die dort vom Kontinent ankommenden Züge mit hunderten Kindern aus Deutschland, Österreich und Tschechien steht, an der ich oft mit großer Rührung vorbeiging. Der Film zeigt den alten Tim Watkins, der sich immer wieder an diese Zeit zurückerinnert, die in eindrucksvollen Rückblenden das nach der Annexion des Sudetenlandes massive Flüchtlingselend, das sich in Prager Hinterhöfen abspielte drastisch zeigt. Tim, der eigentlich auf einen Schiurlaub nach Prag gekommen war, wird dort in eine britische Flüchtlings-NGO katapultiert und schließt nach mehreren Rundgängen, daß vor allem Kinder gerettet werden müßten. Mit eindrucksvollem Insistenz beackert er jüdische Organisationen zur Herausgabe von Listen mit Vulnerablen (sie fürchten, dass diese in die Hände der Nazis fallen könnten), organisiert Züge und mithifle seiner sehr resoluten Mutter und Freunden in London beschafft er Visa und vor allem Aufnahmefamilien, bis er insgesamt 669 Kinder nach England bringt. Der letzte Zug sollte am 1.9.39 abfahren, wird von heranstürmenden SS-Männer aufgehalten, sodaß 250 Kinder nicht mehr gerettet werden. In den 1980er Jahren in London versucht Winton, zum 50-Jahr Jubiläum mediales Interesse zu wecken, doch schasselt ihn ein Freund damit ab, daß “Flüchtlinge kein Thema seien”. Durch Zufall geriet er an des Zeitungstycoon Maxwells Frau und bekommt eine Einladung in die Trash-Show “That’s Life”, wo er mit einer der von ihm Geretteten zusammentrifft, die sich tränenreich bedankt. In einer weiteren Show werden etwa 100 von ihm damals Gerettete eingeladen. In der Zwischenzeit wird gezeigt, dass er selbst ein ganz normales Leben führt und sich jedenfalls nicht als Held sieht. Sehr eindrucksvoll!
Gaea Schoeters hochgelobtes Buch “Trophäe” löst einen richtigen Schock aus. Es geht um einen betuchten amerikanischen Großwildjäger, der jahrelang im gleichen Gebiet mit demselben Organisator große Tiere (“Big Five”) jagt und seine Fünf mit einem Nashorn vollständig machen will. Hungter White, so der Name des Jägers, ist Jäger mit Leib und Seele, sieht in der Großwildjagd einen ebenbürtigen Kampf zwischen Tier und Mensch und sieht die anfallenden Trophäen nur als Nebenprodukt. Der ganze Prozeß des Aufspürens, des Anschleichens, des Findens der richtigen Schußposition, wobei er durch Augenkontakt mit dem Tier ein gewisses “Einverständnis” dessen mit seinem nahenden Tod erkennt, und das gesamte Drumherum werden von der Autorin packend beschrieben. Als Hunter durch eigenen Fehler das Nashorn entgeht, offeriert ihm der Organisator “ein Sechstes”, d.i. ein Mensch, einer der jungen Fährtensucher, als unaussprechlichen höhepunkt. Hunter ist zuerst schockiert, doch erklärt ihm der Organisator, daß der gesamt Stamm von den Wildlizenzen lebt, daß er für den Stamm ein riesiges Jagdgebiet gekauft habe, wodurch dieser seinen Traditionen leben könne – und daß es für den Stamm und seine Bewohner akzeptabel sei, dieses Menschenopfer dazubringen, da es Hunter 500.000 $ kosten würde und er darüber hinaus den ihn unterstützenden jungen Fährtensucher auf ein Stipendium in den USA mitnehmen müsse. Nach längerer Gewissenserforschung siegt der ultimative Jagdkitzel; er geht mit dem Jungen auf die Jagd des anderen, hat schwere Albträume, ist sich auch unsicher, ob die beiden Jungen sich nicht verabredet hätten und ihn umbringen wollten, wird aber nach drei Tagen Spurenverfolgung in einer Schlucht endlich seines Wildes gewahr – verfehlt aber durch den gesuchten Augenkontakt den Todesschuß und verletzt sein Opfer nur schwer. Er weigert sich, den Gnadenschuß zu geben, letztlich bricht der Fährtensucher seinem Freund das Genick. Beim schwierigen Rückweg mit der “Beute” steigt Hunter auf einen schwarzen Skorpion im Schuh und stirbt qualvoll nach längerer Zeit. Das Buch endet mit der Ankunft eines Flugzeugs in den USA, der junge Fährtensucher sieht aus dem Fenster wie ein Sarg und eine Kiste (die Trophäe) ausgeladen wird. Eine wirklich schockierende sehr ungewöhnliche Geschichte, die es schafft, den Großwild- und Menschenjäger als nicht unsympathisch zu zeigen.
Düsterer und beklemmender als in Martin Kusejs Inszenierung von “Orpheus steigt herab” (Tennessee Williams) geht es kaum: die Südstaaten-Kleinstadt, wo jede/r mit jeder/m verstrickt ist, der Ausländerhass, der Druck gegen (vemreintliche) Aussenseiter und die überall lodernde Gewalt. Das Geschäft des “Spaghettifressers” wird niedergebrannt, seine Tochter Lady (sehr beeindrucken Lisa Wagner) zwangsverheiratet mit dem viel älteren todkranken Jabe (Martin Reinke, eher hölzern), die eine Abtreibung zu verdauen hat undauf Rache sinnt, seit sie weiß, dass auch ihr Mann ihren Vater verbrannt hat, ein zufällig vorbeifahrender (Autopanne) Sänger Val (exzellent Tim Werths) kommt vorbei, freundet sich mit der Außenseiterin Carol (Nina Siewert) an und kommt letztlich Lady als Angestellter – gegen seinen ursprünglichen Willen – nahe und schwängert sie. Er ist kein Macho, will mit seinem Vagabundenleben Schluss machen, kommt aber in sehr reduzierten Dialogen (so die gesamte Inszenierung) Lady und Carol (?) näher und damit in den Strudel der bigotten Kleinstadt. Drastisch sieht man die Verbrennung Ldays Vaters und seinem Geschäft ajufleuchten, hört im Hintergrund manchmal offenbar Bluthunde Lynchaktionen begehen, sieht die Dorfmänner ihr Unverständnis gegen jeder Abweichung hervorzeigen und lernt letztlich, dass Lady Val hauptsächlich als Instrument benutzt, um im Andenken an ihren Vater das Schuhgeschäft ihres todkranken Mannes in eine Glitzerbar umzuwandeln. Wie bei Williams zu erwarten, gelingt das kleine Glück nicht, die beiden werden von Jabe erschossen, der bei der Abfackelung seiner selbst und seines Hauses in die Welt hinausposaunt, dass Val Lady erschossen habe: auch im eingenen Untergang muss das korrekte (“woke”) Image aufrechterhalten werden. Immer wieder tritt ein geheimnisvoller Sänger, Oliver Welter, auf, der die Handlung mit an Country-Jazz erinnernden Songs begleitet, das Englisch leider oft schwer verständlich. Erstaunlich die Regie-Parallelen zur “Verwandlung” (unten): der Erzähler/Sänger und die Darstellung hier von im vertikalen Autowrack Sitzenden und der vertikal gezeigten Schwester Gregors (dort). Ein sehr eindrücklicher Abend, karge Dialoge zeigen die Spracharmut der Kleinstadtbewohner auf, die überall lauernde Gewalt, die sich Durchbruch verschafft. Lange andauernder, verdienter, Applaus.
(Persönlicher Nachtrag: bei einem Englandaufenthalt an der Uni von Birmingham wurde ich 1960(!) in einem Kurs über US-amerikanische Literatur erstmals mit Orphes Descending konfrontiert und es immer irgnedwie im Hintergrund-Gedächtnis behalten. 2008 habe ich einmal 2008 in London eine (schwache) Aufführung gesehen, bin froh, dass Kusej zu seinem Abschied diese erinnerungswürdig gemacht hat).
Die fantastische Inszenierung Lucia Bihlers von Franz Kafkas Novelle “Die Verwandlung” im Akademietheater hat das Publikum (zurecht) zu minutenlangem Applaus hingerissen. Bihler gelingt es, die bedrückende Stimmung, die Gregor Samsas Verwandlung “nach unruhigen Träumen” in ein riesiges Ungeziefer, überall verursacht, perfekt herzustellen. Immer wieder wird dieser erste Satz der Novelle zitiert „Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt“), allein stehengelassen und wird immer eindringlicher, immer wieder wird Samsa als Insekt in seinem an Van Goghs Zimmer (oder Kirchners Darstellungen) erinnernden grell vielfarbigen “Kerker” durch vielfältige Wiederholungen in unterschiedlichen Größen an seine neue Existenz erinnert, obwohl ihm dadurch keine negative Gefühlsregung anzumerken ist, nur Verwunderung, dass er seinen Zug als Handelsreisender nicht erreichen kann. Im Gegensatz zu seiner konsternierten Familie, die ihm angstvoll und mit Grausen entgegentritt, Mutter, Vater und geigenspielende Schwester Grete, die noch am ehesten Berührungskontakt im Gregor findet. Im weiteren wird klar, dass die Familie “es” loswerden will, da man Reputationsverlust gegenüber den Nachbarn fürchtet, aber doch sehr auf des früheren Gregors Einkommen als einziger Familienerhalter angewiesen ist. Letztlich stribt der eingesperrte Gregor unter einem riesigen Apfel (?), die Familie (Dorothee Hartinger, Philipp Hauss, Stefanie Dvorak) hat Jobs und das Leben geht weiter. Grandios die DarstellerInnen, vor allem Paulina Alpen in der Figur des Samsa, die akrobatisch den Unterscjhied der Körperlichkeit des früheren und jetzigen Gregor darstellt, aber auch die anderen. Toll die Kostüme, sowie die Darstellung der Handlung, die durch (von Kafka?) gelesene Textpassagen Dialoge ersetzt. In dieser Inszenierung wird die Einsamkeit des einzelnen, vor allem aber die Dominanz der Erwerbsarbeit in der persönlichen Beziehung apostrophiert, Die vielen anderen, an die Mittelschulzeit erinnernden Interpretationen bleiben in dieser im Gedächtnis fest verhaftenden Inszenierung außen vor.
Für den Booker Prize nominiert und von der Kritik hoch gelobt ist Elif Shafaks “Das Flüstern der Feigenbäume” (original auf Englisch “The Island of the Missing Trees”, Viking 2001), welches die Geschichte einer türkisch-griechischen, also verbotenen, Liebe auf Zypern erzählt und die Zeit vor dem Bürgerkrieg bis ins heutige England umspannt. Die einzelnen Episoden der jungen Liebe zwischen Kostas und Defne im noch gemeinsamen Nikosia, seine Reise (ohne Wiederkehr) nach England als Schutzschild, wird durchbrochen von Gedanken und Beobachtungen eines Feigenbaums, der im Hof eines türkisch-griechischen Restaurants steht, in welchem sich die jungen Liebenden heimlich treffen. Shafak bedient sich einer sehr poetischen Sprache, die sobald sie die Liebenden betrifft, lakonisch und auch leicht kitschig wird – im Gegensatz zu den Überlegungen der Feige, die nicht nur über das Leben unterschiedlicher Bäume und Tiere räsonniert, sondern auch kühl aus Außensicht die Geschehnisse in der Türkei, das Zusammenleben, die Trennungen, die Ultranationalisten auf beiden Seiten, die türkische Invastion 1974, die britische Besatzung, die Umtriebe Makarios, aber auch die einzelnen Gräuel und Schandtaten beschreibt – oft ein Labsal nach den eigenartig abstrakt bleibenden Beschriebungen der Liebenden. Nach Jahrzehnten in London kehrt Kostas zurück ins geteilte Zypern, findet seine geliebte Defne als Anthropologin, welche Leichenteile exhumiert und den Verwandten zum Begräbnis zurückgibt, knüpft fast nahtlos mit ihr an das frühere Liebesleben an, erfährt im Detail von vielen Verbrechen und überredet sie, mit nach London zu gehen, wo sie ein Kind (Ada) bekommen, er als Biologe weiter arbeitet und – ganz wichtig – sie gemeinsam einen Ast aus dem Feigenbaum der Taverne hochziehen, als Erinnerung an ihre verlorene Heimat. Defne unterliegt dem Krebs, Ada weiß nichts von Zypern bis eine Tante auftaucht und ihr die damaligen Verhältnisse schildert. Verwunderlich ist zweierlei: zum einen erfährt man nie, in welcher Sprache Kostas und Defne sich verständigen; zweitens, wahrscheinlich wichtiger für einen Liebesroman, wird die Liebe der beiden – trotz aller Fährnisse und Trennungen – als gegeben angenommen und nie als Gedankenspiel als Überlegung als Gefühl verbalisiert: sie ist einfach da und überdauert alles.
Informativ und erfreulich zu lesen ist das bereits 2004 bei Harpers’s erschienene “How Soccer explains the World – an (unlikely) theory of globalization” des New Republic Herausgebers Franklin Foer – eines wahren Fußballfreundes. In einzelnen Kapiteln, die geographisch geordnet sind, beschreibt er Fußball als “Gangsterparadies” (Serbien im Bürgerkrieg mit Arkan als Red Star Sponsor), als Heim der “Pornographie von Sekten” (Celtic vs. Rangers in Schottland, wobei Celtic als irischer (katholischer) Klub von den rechtmeinenden Protestanten der Rangers verteufelt wird), als Ausdruck der “Judenfrage” (die Wiener Hakoah vor dem Krieg, Tottenham und Austria heute), als Heim des “Sentimentalen Hooligan” (Chelsea mit antisemitischen Ausschreitungen), als Garant für “das Überleben der Zylinder” (Brasiliens Vasco da gama Club), als Charakterisikum der “Schwarzen Karpather” (die Ankunft nigerianischer Fussballer im ukrainischen Klub Karpaty Lviv), als Hort der “Neuen Oligarchen” (die Agnellifamilie bei Juventus Turin, Berlusconi bei Milan), als Ausdruck des “diskreten Charms des bürgerlichen Nationalismus” (FC Barcelona), als “Islamische Hoffnung” (Entdeckung der Popularität des Fussballs durch die iranische klerikale Regierung), sowie als Erklärung der “Amerikanischen Kulturkriege” (Fussball als “europäischer_ Wert” gegen den wahren US-Wert American Football). All das ist äußerst informativ über Entstehung und Stellenwert des Fussballs in verschiedneen Weltgegenden und Historien und zeigt durch die jeweilige Instrumentalisierung von Fußball für politische und materielle Zwecke auch dessen Entwicklung vom Community-getriebenen Massensport zum kommerziellen internationalen Business auf. Mit Globalisierung hat das nur insofern zu tun, als der Weg zum Kommerz meist über den Ein- und Verkauf internationaler Spieler läuft, die den jeweiligen Verein in der Liga nach oben pushen sollen: damit geht aber zum Teil auch der wichtige Konnex zum ursprünglichen lokalen Publikum verloren, die zuvor jeden einzelnen Spieler kannten (ich kann das als eingefleischter GAK-Anhänger in meiner Jugend bezeugen) und ihn auch als Lokalrivalen (gegen andere lokale Klubs) schätzten (“Simmering gegen Kapfenberg – das nenn ich Brutalität”). Überzeugender für diesen Übergang und den damit verbundenen Identitätsverlust vieler lokaler Fans finde ich allerdings den Film mit Eric Cantona (Looking for Eric). Zu kritisieren ist vielleicht auch Foers manchmal zu oberflächliche Beschreibung der mit dem Aufstieg der Clubs verbundenen politischen Gräuel (zB Arkan in Serbien, die Eliminierung Mossadeqs im Iran durch den britischen und amerikansichen Geheimdienst nach der Verstaatlichung der Erdölindustrie, auch des Naziregimes), dennoch ist das Buch für viele Fußballanhänger lesenswert, wenn auch nicht unbedingt für Globaliseirungsanalysten.
Die himmlischen Beschreibungen des deutschen Feuilletons über Julia Josts Erstlingsroman “Wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht”, der eben bei Suhrkamp erschienen ist, kann ich nicht teilen. Wie die gekünstelte Skurrilität des Titels, der einer Beschreibung am Ende des Romans entnommen ist, so ist das Buch: allzu bemüht, originell zu sein. Die Geschichte eines etwa 11-jährigen Kärntner Mädchens, das auf einem Gasthaus/Bauernhof im hintersten Kärnten aufwächst, beschreibt den Zwiespalt ihrer eigenen Entwicklung, ihrer Zuneigung (Liebe?) zu einem zugewanderten bosnischen MÄdchen und ihrer zum Wohlstand aufgestiegenen Familie, die überall hervorlugende Nazi-Vergangenheit der Umgebung, die sich nahtlos in klein-kriminelle Handlungen und Beziehungsgeflechte fortsetzt, ist interessant erzühlt, jedoch von einer sich selbst immer wieder feiernden Ausstellung von Kärntner Dialekt-Sagern, kursiv gedruckt und im nächsten Satz hochdeutsch erklärt: das mag kunstvoll sein, ist aber offenbar auf den deutschen Leser gezielt und damit eher artifiziell als authentisch. Und außerdem wirklich ärgerlich, vor allem die hohe Frequenz des “Focknhocker”, eines ununterbrochen vorkommenden heruntergekommenen “Kärntner Originals”: was dieser Name zu bedeuten hat, wird nicht erklärt, offenbar dient seine Figur als Spiegelbild des Kärntnerseins. Mir kommt das Ganze eher gekünstelt als kunstvoll vor, der deutsche Hype erfreut sich offenbar an den Carinthizismen, und den Grausamkeiten dieser Kärntner dystopischen Nicht-Idylle.
Sehr empfehlenswert ist der Film “I Giacometti”, über die Giacometti-Familie aus dem Bergell in Graubünden. Der film ist nicht nur ein Malerporträt, oder ein Bildhauerproträt von Alberto Giacometti, sondern behandelt die Familiengeschichte, die sehr enge familäre Bindung von Vater Giovanni, Mutter Anna, den Brüdern Alberto, Bruno und Diego, sowie Schwester Ottilia, alle künstlerisch begabt und tätig, die immer wieder zur Familie im Bergell am Malojapass zurückkehren und in sehr persönlichen Briefen und Begegnungen ihre enge Verbundeheit zur Heimat und Familie leben. Der Film ist exzellent und sehr einfühlsam gemacht, ohne Sensationalismus, ohne Hervorheben der einzelnen, berühmter gewordenen Mitglieder. Mich hat er besonders berührt, da ich nicht nur Alberto G. sehr schätze, sondern auch dreimal in Salecina, einem Alternativ-Ferienheim am Malojapass, Wochen verbracht habe, wo ein Züricher “linker” Buchhändler Theo Pinkus eine Begegnungsstätte für italienische, deutsche, Schweizer und Österreichische Alternative durch den selbstorganisierten Umbau eines alten Bauernhauses errichtet hatte, und ich anfangs der 1980er Jahre, und dann später in den 1990er Jahren wunderschöne Schiwochen verbracht hatte, und dort auch die Giacometti-Geschichten hautnah mitbekam. (Beim letzten Aufenthalt wurde leider die gesamte Belegschaft des Hauses von einem akuten Darmvirus befallen- wahrscheinlich verursacht durch die Abwachsfetzen, mit denen das Geschirr in Gemeinschaftsarbeit gewaschen wurde – was die Sanitäranlagen für die 70 Personen massiv beanspruchte). Dennoch; die wunderbare Landschaft des Bergell, die fantastischen Schimöglichkeiten des St. Moritzer Beckens, die tollen Begegnungen mit deutschen, italiensichen und Schweizer Ähnlich-Gesinnten, waren sicher “leichtere” Erfahrungen als jene der Giocomellifamilie
Über die Unkenntlichkeit hinaus entstellt ist das von Johan Simons inszenierte Drama Goerg Büchners “Dantons Tod”. Welcher Teufel hat ihn geritten, das gesamte Stück von Clowns in einem Zirkus (?) dazustellen, wobei durch das immer gleiche Bühnenbild, durch die akustisch schwer verständliche Sprache, vor allem das vielfache Schreien (auch mit dem Rücken zum Publikum) dem nicht Büchnerspezialisierten Zuseher vollkommen unklar ist, welcher Teil des Dramas eigentlich abgeht und worum es dabei geht? Ausser den Zwiegesprächen zwischen Danton und Robespierre, Danton und Demoulin, den Tiraden StJusts hat man keine Ahnung, ob man gerade im Kerker, in der Verhandlung oder anderen Teilen der Handlung ist. Die bei Büchner tiefgründigen Philosophierereien über die Gestalt der künftigen Gesellschaft, über den Tod, über das Ziel der Revolution – alles geht unter in clownesken Schreiereien. Ja, gegen Ende spürt man, dass Danton (dessen Identität ich erst zu Ende des 1. Aktes erkannt hatte) von Lebensüberdruss und Todessehnsucht besessen ist, als Zauderer und Zögerer sowohl Massenmorde verursacht als auch mögliche Flucht versäumt hat, aber da ist die Frustration über diese unmögliche Inszenierung schon weit gediehen. Welche Schauspieler gut waren, kann man bei dieser Kasperliade nicht sagen. Dass Simons damit vielleicht “Die Revolution frisst auch ihre Clowns” sagen wollte, kann nur ein schlechtes Gerücht sein.
Francis Poulenc’s Dialogues des Carmelites in der Staatsoper hinterließ zwiespältige Gefühle: eine sehr katholisch-klosterhafte Hauptgeschichte über den Wunsch von Blanche, der Fürstentochter, ihre Ängste (vielleicht auch inzestuöse Gefühle zwischen ihr und ihrem Bruder?) durch den Gang ins Kloster zu überwinden, was sehr individuell-psychologisierend wirkt, einer sehr ansprechendne Inszenierung (Magdalena Fuchsberger), die durch ein fantasievoll-funktionales Bühnenbild, bei dem die Drehbühne mithilfe eines durchsichtigen mehrstöckigen Stabgebäudes die unterschiedlichen Szenen beleuchtet, und einer in den ersten beiden Akten eher konventionellen, manchmal fast langweilig unterspielten Musik Poulencs, die erst im letzten Akt, bei dem die Nonnen durch ihre Ablehnung der revolutionären Bewegung Frankreichs der Reihe nach auf dem Schafott landen, nachdem sie sich das Gelübde des Märtyrertums gegeben haben, dem dramatischen Drehbuch gerecht wird. Äußerst ansprechend is, dass Bertrand de Billy (den ich als Chef des London Symphony Orchesters schätzen gelernt hatte) das exzellente Orchester quasi als Begleitung der Singstimmen agieren läßt, diese also – wie ungewohnt in letzter Zeit – nicht mit Gewalt sich Gehör verschaffen müssen. Wenn ich an Ligeti oder Britten denke, bleibt Poulenc als Opernkomponist zurück: er ist eher im Korngoldlager – nicht schlecht, aber nicht aufregend.
Exzellent die vielen Frauenstimmen, allen voran Nicole Car als Blanche, aber auch die anderen bleiben nicht zurück. Erfrischend auch der Tenor Bernard Richters als Blanches Bruder. Düster die immer wieder erscheinenden Monster, die Dämonen oder nahenden Tod der Protagonistinnen anzeigend, rätselhaft (für mich) die weiße Gestalt, in der Kostümierung an Hermes (Flügel am Helm) erinnernd. Die hier gewählte Interpretation, dass Blanche, die sich im Kloster durch ihre Freundin Constance an einen gemeinsamen Todestraum erinnert, nicht nach ihrer Flucht aus dem Koster den Nonnen zum Schafott anschließt, sondern zum Zeitpunkt als Constances Kopf fällt, mit gebrochenem blutenden Herzen tot zusammenbricht, ist stimmig.


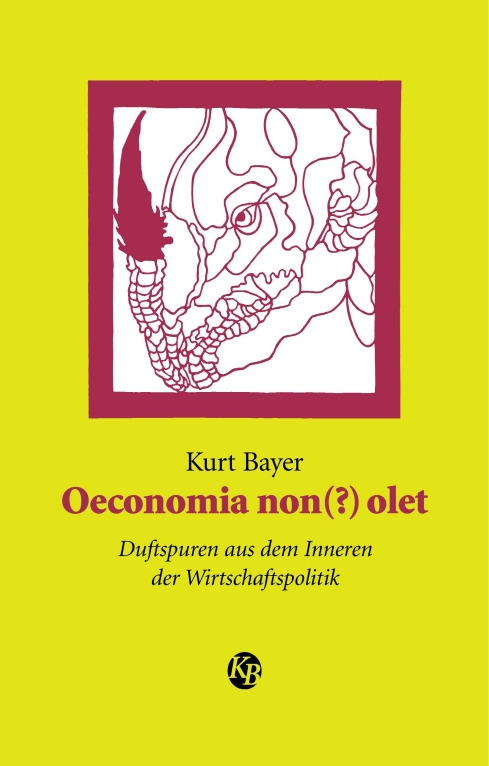



Johan Simons hat schon die Geschichten aus dem Wienerwald völlig entstellt und kastriert. Daher ist sein Name im Programm für mich der Garant dafür, dass ich sicher nicht hingehe. Danke für die Bestätigung meines Vorurteils ohne dass ich mich zwecks kritischer Hinterfragung stundenlang quälen muss.
Es gibt so viele radikale Inszenierungen und auch Überschreibungen, die neue Perspektiven eröffnen.
Schade für den Aufwand und die versäumte Gelegenheit