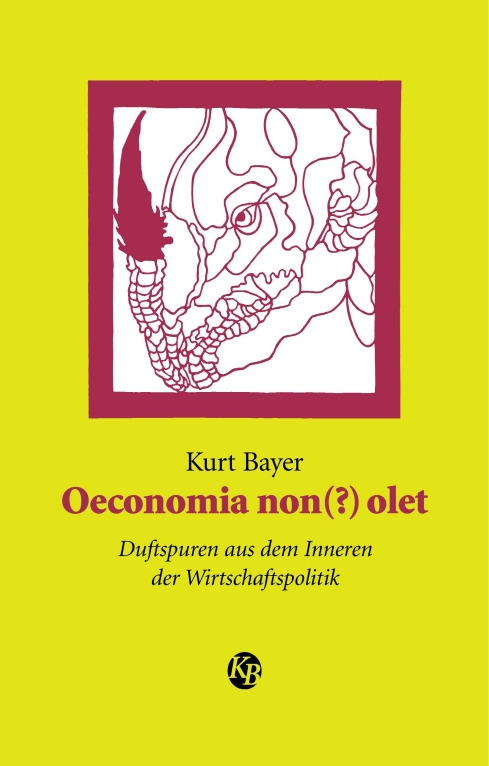Kurt Bayer
(Reprint eines Artikels im Neuen Forum 1975 (!!) aus Anlaß der aktuellen Diskussion)
(Die Tabellen und Grafiken sind im Link http://forvm.contextxxi.org/wer-gewinnt-die-inflation.html einsehbar, konnte sie nicht reproduzieren, sorry)
Lohn-/Preis-Spirale und Einkommensverteilung in Österreich 1967—74
Die Schamteile der bürgerlichen Ökonomie sind die Gewinne, über sie wird peinlich geschwiegen. Schon der Terminus Lohn-/Preis-Spirale soll suggerieren, daß nur der Lohn und nicht etwa der Profit die Preise treibt. Die Fakten sagen’s umgekehrt.
Der junge österreichische Nationalökonom Kurt Bayer hat die Zahlen erstmals so übersichtlich zusammengestellt, daß man das gegenseitige Verhältnis von Lohn, Profit und Steuer (also Arbeiter, Bourgeoisie und Staat) in seiner dynamischen Entwicklung während des letzten Zyklus 1967—74 mit einem Blick erfassen kann. Er folgt dabei methodisch einer Arbeit von Aike Blechschmidt [1] der zuvor dasselbe für die Bundesrepublik geleistet hat. Indem wir die Tabellen und Grafiken nebeneinanderstellen, bekommen wir zusätzlich noch einen interessanten Vergleich der beiden Wirtschaften — zumal Österreich ja weitgehend von der BRD abhängt.
1 Propaganda und Volksmeinung
Die „freien Marktwirtschaften“ des Westens haben seit Anfang der siebziger Jahre die höchsten Inflationsraten nach dem Zweiten Weltkrieg. In Österreich stiegen die Inflationsraten, sprich Verbraucherpreisindex (VPI), [2] von 2,8 Prozent im Jahre 1968 bis auf knapp zehn Prozent im Jahre 1974. Die wirkliche Aufwärtsbewegung der Preise setzte jedoch nicht, wie viele glauben, erst mit der sogenannten „Ölkrise“ Ende 1973 ein, sondern sie kann seit den Jahren 1970 (4,4 Prozent nach 3,1 Prozent im Vorjahr) und 1972 (6,3 Prozent nach 4,7 Prozent) datiert werden.
Um den heimischen Ursprung der Inflation zu erklären, wird häufig das Bild von der Lohn/Preis-Spirale verwendet. Dieser sehr anschauliche Vergleich suggeriert, daß die Löhne die Preise nach oben treiben. Nicht zufällig wird dieser Vergleich von Unternehmern und deren Vertretern gebraucht, aber auch — und das ist doch recht erstaunlich — von Experten der „Arbeitnehmerseite“. Ist das Bild von der Lohn/Preis-Spirale einmal fest in den Köpfen verankert, bleibt als Lösungsmöglichkeit des Inflationsproblems nur die „Einkommenspolitik“, sprich Lohnpolitik, über. Denn es ist ja klar: wenn die Lohnsteigerungen an der Inflation schuld sind, liegt es nahe, zur Bekämpfung der Inflation bei den Löhnen anzusetzen. Opfer, so heißt es, müssen wir alle bringen, wenn wir die Inflation loswerden wollen …
Die Inflationsproblematik ist wesentlich eine Verteilungsproblematik. Jede Politik, welche die Inflation beeinflußt, hat gleichzeitig Auswirkungen auf die Einkommensverteilung. Die Inflation kann also nur im Zusammenhang mit dem Verteilungskampf gesehen werden. Dazu müssen wir die Rolle der einzelnen Verteilungskomponenten im letzten Konjunkturzyklus analysieren.
Es wird hier also nicht versucht, die Inflation zu „erklären“, d.h. ihren Ursprung erschöpfend aufzuzeigen (vgl. dazu den Artikel von Aike Blechschmidt in diesem Heft).
2 Wie funktioniert der Konjunkturzyklus?
Wir gehen von folgendem Konjunkturmodell aus, das dann anhand von empirischen Daten überprüft wird: Die Rezession ist gekennzeichnet durch geringe Nachfrage nach Investitions- und Konsumgütern, durch relativ schlechte Kapazitätsauslastung; so entstehen relativ hohe Lohnkosten, da die Beschäftigten nicht gleich schnell mit der zurückgehenden Nachfrage abgebaut werden können und die Lohnzuwächse noch von der Hochkonjunktur bestimmt sind. Durch die daraus resultierende geringe Investitionsneigung kommt es zu einem Rückstau an Neu- und auch Ersatzinvestitionen, da die Gewinnsituation schlecht ist und vorhandene Gewinne eher für Rückzahlungen als für Investitionen verwendet werden. In dieser Phase wird durch den Slogan von der „Überbeschäftigung“, durch Entlassung von Lohnabhängigen und die daraus resultierende Angst um den Arbeitsplatz die Position der Lohnabhängigen im Verteilungskampf für die nächste und weitere Zukunft geschwächt. Man behauptet, die Lohnsteigerungen der letzten Zeit seien überhöht gewesen und hätten die Krise herbeigeführt oder würden sie herbeiführen, wenn nicht in Zukunft Zurückhaltung geübt würde (wie eben jetzt in Österreich). Die „Überbeschäftigung“ und die daraus resultierende „Minderung der Arbeitsdisziplin“ seien die Wurzel des kommenden Übels, der „soziale Friede“ sei gefährdet.
Aus den die Rezession auslösenden und verstärkenden Gründen steigt im Konjunkturaufschwung die Produktivität (das Produkt je Erwerbstätigen) sehr rasch an. Durch bessere Auslastung der Maschinen sinken die Stückkosten, aber auch dadurch, daß die Beschäftigung nicht im gleichen Ausmaß ausgeweitet wird wie die Produktion, sowie dadurch, daß die Löhne aufgrund der noch vorhandenen Krisenangst um den Arbeitsplatz nur relativ langsam steigen. Das bedeutet aber, daß in dieser Phase die Profite stark zunehmen. Dadurch wird die Nachfrage nach Investitionsgütern angekurbelt, was auch zu einer langsamen Steigerung der Konsumgüter-Nachfrage führt, da die Einkommen der Lohnabhängigen steigen (wenn auch weniger stark als die Produktivität). Durch die mindestens einjährige Laufzeit der Tarifverträge sowie durch die weiterwirkende Schwächung der Lohnabhängigen in der eben überstandenen Rezession hinken die Lohnsteigerungen beträchtlich hinter der Produktivitätssteigerung nach.
Erst in der Hochkonjunktur, wenn durch steigende Preise, die im Aufschwung leicht überwälzt werden können, bei den Lohnabhängigen sich der Wunsch nach einem gerechten Anteil am gestiegenen Produkt durchsetzt, besteht die Möglichkeit, einen Teil der stark gestiegenen Profite durch höhere Lohnforderungen wettzumachen. Dies wird hauptsächlich dadurch möglich, daß sich die Position der Lohnabhängigen durch die zunehmende Knappheit an Arbeitskräften verbessert. Solange die Unternehmer die Möglichkeit zu einer Vergrößerung der Gewinne haben, werden sie versuchen, Produktion und Umsätze auszuweiten. Die Position der Lohnabhängigen in den Lohnverhandlungen kann natürlich geschwächt werden durch massiven Einsatz von (billigeren) ausländischen Arbeitskräften, die eine weitere Steigerung der Produktivität ohne entsprechende Lohnsteigerungen ermöglichen und damit eine weitere Ausweitung der Gewinne.
Gelingt es aber den Lohnabhängigen in der Hochkonjunktur, die Reallöhne stärker zu erhöhen, als in dieser Phase die Produktivität wächst — und dies ist notwendig, um die im Aufschwung zugunsten der Unternehmer sich verkehrende Einkommensverteilung wieder einigermaßen zu korrigieren —, und verzichten die Unternehmer in dieser Phase dann nicht auf einen Teil der ihnen zur Gewohnheit gewordenen Gewinne, dann kommt es zu der berüchtigten „Überforderung des Sozialprodukts“ (worunter diejenigen, die das sagen, aber nicht ein Beharren der Unternehmer auf ihren hohen Gewinnanteilen verstehen!). Das Beibehalten dieses Gewinnanteils bewirkt also unweigerlich Preissteigerungen.
In diesem Moment wird jedoch die Parole von der „produktivitätsorientierten Lohnpolitik“ ausgegeben, von der im Aufschwung, als die Löhne hinter der Produktivität zurückblieben, niemand gesprochen hatte. Erst in der Hochkonjunktur (in Österreich seit 1971), wenn ein Aufholprozeß der Löhne beginnt, wird das Menetekel einer Krise an die Wand gemalt und den Lohnabhängigen die Verantwortung für das weitere Schicksal der Konjunktur aufgebürdet.
Da in der Hochkonjunktur die Nachfrage noch steigt, überwälzen die Unternehmer zur Gewinnsicherung die Preise um so stärker, je weniger erfolgreich sie in der Lohnpolitik sind. In Österreich zeigt sich dies deutlich in den Indexsprüngen 1971/72 und 1973/74, also in Phasen, in denen die Reallohnzuwächse die Produktivitätszuwächse überstiegen. Zu diesem Zeitpunkt tritt auch die Propaganda von der Lohn/Preis-Spirale auf den Plan, es wird verkündet, daß über den Produktivitätszuwachs hinausgehende Lohnsteigerungen „die Wirtschaft“ und die Arbeitsplätze gefährden. Tritt dann tatsächlich ein Abschwung ein, wo der Unterschied zwischen nominellen und realen Lohnsteigerungen immer größer wird (obwohl wegen der schwächer wachsenden Nachfrage die Preise nicht mehr vollüberwälzt werden können), so werden die Lohnabhängigen für diese Entwicklung verantwortlich gemacht. An das Vorauseilen der Gewinne im Aufschwung denkt niemand mehr.
Im folgenden wird untersucht, inwiefern die obigen Thesen über Konjunktur und Inflation auf den letzten Konjunkturzyklus in Österreich (d.h. 1967 bis heute) zutreffen. Sind aus der Divergenz Produktivitätswachstum/Lohnwachstum Impulse zur Inflation ausgegangen? Und wenn ja, von welcher Gruppe? Stimmt unsere Hypothese, dann kann man nicht von einer Lohn/Preis-Spirale reden, sondern höchstens von einer Profit/Preis/Lohn-Spirale. Bei der Analyse der Lohnentwicklung wird das Augenmerk auf die für die Unternehmer wichtigen Lohnkosten gelegt, also jene Löhne, die sie tatsächlich ausbezahlen. Denn diese Löhne sind hauptsächlich für das Lohn/Preis-Spirale-Argument relevant. Es wird auch aufgezeigt, welche anderen Lohnaggregate in der Statistik existieren und welche Rolle sie in dieser Debatte spielen. Weiters wird die Entwicklung der Einkommensverteilung in Österreich 1967-74 untersucht. Hier wird neben Löhnen und Gewinnen auch die Rolle des Staates als Einkommensbezieher analysiert, da er ja u.a. durch Steuerpolitik in diesen Komplex eingreift.
3 Sind die Löhne schuld?
Wie haben sich Löhne und Produktivität im laufenden Konjunkturzyklus entwickelt? Wenn die Löhne stärker gestiegen sind als die gesamtwirtschaftliche Produktivität, dann muß sich die Realverteilung der Einkommen zugunsten der Löhne entwickelt haben. Sind sie weniger gestiegen, dann haben die Gewinne an Boden gewonnen. Die Frage ist also, ob von der Lohnentwicklung her, gemessen am Produktivitätswachstum, ein Anlaß gegeben war, die Preise zu erhöhen oder nicht. Wenn die Löhne stärker steigen als die Produktivität, mußten die Unternehmer die Preise erhöhen, um ihren Anteil am Volkseinkommen bzw. am „verteilbaren Produkt“ gleich zu halten.
Zunächst ein kurzer Hinweis auf die verwendeten Begriffe und Definitionen.
Produktivität
Verwendet wird hier die Reihe Bruttonationalprodukt je Erwerbstätigen in Preisen von 1964. [3] Grundsätzlich sollte eigentlich nur die „private“ Produktionsentwicklung [3a] (also ohne öffentlichen Sektor) je „privatem“ Erwerbstätigen herangezogen werden, doch ist diese Größe in der offiziellen Statistik nicht ausgewiesen und nur schwer zu errechnen.
Löhne
Ausschlaggebend für die Lohn/Preis-Zusammenhänge sind die Lohnkosten, also jene Löhne, die in die Kalkulation der Unternehmer eingehen. Gewöhnlich werden die Bruttolöhne als Maß für die Lohnentwicklung verwendet. Für den hier beobachteten Zeitraum ist dies jedoch problematisch, da von 1968 bis 1974 der Anteil der Lohnsteuer am Bruttolohn von 5,7 Prozent auf 8,2 Prozent anstieg, also um zirka die Hälfte. Diese Entwicklung geht auf das veraltete Steuersystem zurück, durch das immer mehr Einkommen in die höheren Progressionsstufen gelangen (trotz der sich in den letzten Jahren wiederholenden „Steuerreformen“). Es ist also bei der Analyse der Lohn/Preis-Zusammenhänge vom Steuergesichtspunkt abzusehen, um nicht Lohn- und Steuerpolitik zu vermischen. Daher werden die Nettolöhne, also nach Abzug der Lohnsteuer (aber inklusive Sozialabgaben), untersucht. Um den Lohnkosten-Standpunkt durchzuhalten, müssen auch die vom Staat bezahlten Löhne außer acht bleiben, da diese durch Steuern oder Kredite finanziert werden und daher von der Kostenseite her keinen Einfluß auf Preiserhöhungen nehmen können. Im weiteren verwenden wir also „private“, das sind von Unternehmern bezahlte Löhne und Gehälter. (Die Definition des Staates folgt der der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung.) [4]
Wir beginnen mit dem üblichen Produktivitäts/Lohn-Vergleich (also Gesamtproduktivität und Bruttolöhne) und zeigen, wie sich dieses Bild verändert, wenn man die dem untersuchten Gesichtspunkt angepaßten Daten verwendet. Dies dient einerseits dazu, die tatsächliche Entwicklung aufzuzeigen, andererseits, um zu zeigen, welche Verzerrungen (Bias) durch die Verwendung ungeeigneter Daten entstehen können.
Die private Produktivität entwickelt sich wahrscheinlich relativ ähnlich der gesamtwirtschaftlichen. [5] Höhepunkt des laufenden Konjunkturzyklus, gemessen an der Produktivitätsentwicklung, war das Jahr 1970, dann gab es 1971 einen leichten Einbruch, 1972 wieder einen Nebengipfel. Leicht abgeschwächt, dauert die Hochkonjunktur bis Ende 1974 an. Dies bedeutet den längsten Konjunkturaufschwung in Österreich seit Ende des Zweiten Weltkrieges (im Durchschnitt dauerten die Aufschwünge der bisherigen Zyklen zwei bis drei Jahre, der jetzige schon fast sieben).
Nominelle Lohn- und Gehaltssumme
Die nominelle Lohn- und Gehaltssumme bzw. die volkswirtschaftlichen Löhne und Gehälter ohne Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und ohne angerechnete Pensionen im öffentlichen Sektor ist der am häufigsten verwendete Begriff, wenn es um Lohnsteigerungen geht (Tabelle 1, Spalte 2). Dieses Aggregat stieg (außer 1970) in allen Jahren stärker als die Produktivität (siehe Abb. 1). Hiermit könnte jemand versuchen, das Bild von den die Preise treibenden Löhnen zu „beweisen“. Es muß jedoch zumindest die Pro Kopf-Entwicklung analysiert werden, da ja auch die Produktivität je Erwerbstätigem gerechnet ist. Dieser Vergleich (Spalte 3 bzw. Kurve 3) zeigt noch immer, daß „die Löhne“ zumindest ab 1971 stärker als die Produktivität zugenommen haben. Da genau 1971 ein Jahr zunehmender Geldentwertungsraten ist, scheint der Zusammenhang komplett: die über die Produktivität hinaus gehenden Lohnsteigerungen haben den Preisanstieg der letzten Jahre bewirkt.
Im nächsten Schritt gehen wir einerseits zu den privaten Löhnen über, andererseits zum Reallohn.
Reale Lohnsumme pro Lohnabhängigem (privat)
In dieser Betrachtung (Spalte 4, Kurve 4) sehen wir, daß sich das oben gezeichnete Bild vollständig ändert: die Produktivitätssteigerungsraten liegen von 1968 bis 1970 immer stärker über der Lohnsteigerung, 1971 gibt es eine leichte Aufholbewegung der Löhne, die jedoch 1972 und 1973 schon wieder durch stärkeres Produktivitätswachstum mehr als wettgemacht wird. Erst 1974 gelingt es den Löhnen, ein wenig vom früher so stark verlorenen Terrain wettzumachen. Die Frage, ob es gerechtfertigt ist, die Preissteigerungsrate von den Lohnerhöhungen abzuziehen, ob man damit nicht das abzieht, was man ja erklären will, kann so beantwortet werden: die Preissteigerungsraten 1967 bis 1970 können sicher nicht der Lohnentwicklung zugeschrieben werden, da die tatsächlichen (realen) Löhne in dieser Phase nur mit rückläufigen Raten zunahmen. Die Arbeitskosten je produzierter Einheit sanken in diesem Zeitraum und erreichten erst 1970 wieder das Niveau von 1967. [6] In der Argumentation à la Lohn/Preis-Spirale können Lohnzuwächse nur dann inflatorisch sein, wenn ihr Wachstum über das der Produktivität hinausgeht.
Die Lohnabhängigen sahen sich also 1970 mit einer Zunahme der Inflation konfrontiert und versuchten daher 1971, die zu ihren Lasten stark verschobene Einkommensverteilung wieder zu korrigieren. Dasselbe trifft auf 1973/74 zu. Nach diesem Bild kann also von 1967 bis 1970 auf keinen Fall von einem Beitrag der Löhne zur gegebenen Inflation im Sinn der Lohn/Preis-Spirale gesprochen werden. 1971 wurde kurzfristig das in den ersten drei Aufschwungsjahren zu Lasten der Lohnabhängigen verschobene Verteilungsbild korrigiert, doch wurde dies 1972 wieder zugunsten der Nicht-Lohneinkommen wettgemacht. Diese Betrachtung zeigt auch, daß der Abstand zwischen Produktivitäts- und Lohnsteigerung in den Jahren, in denen die Löhne schneller wuchsen (1971 und 1974), viel geringer war als in den Jahren mit umgekehrtem Wachstumsvorsprung.
Reale Nettolohnsteigerung (privat)
Zieht man von den privaten Bruttolöhnen (inklusive Arbeitgeberbeitrag) die Lohnsteuer ab, kommt man zur Nettolohnsteigerung (Spalte 5, Kurve 5 in Tab. 1/Abb. 1). Diese Betrachtungsweise entspricht dem Lohnkostenstandpunkt, vom Unternehmer her gesehen. Denn eigentlich sind es ja nur die Nettolöhne, die sich im Sinn der Lohn/Preis-Spirale auf die Inflation auswirken können. Hier wird eine Vermengung von Lohn- und Steuerpolitik vermieden. In diesen Nettolöhnen sind die Sozialabgaben noch enthalten, weil angenommen werden kann, daß diese früher oder später den Lohnabhängigen insgesamt in Form von Kranken- oder Altersversorgung wieder zufließen.
Das Bild, das sich bei dieser Betrachtung ergibt, ist in seinem Verlauf ähnlich wie das vorige, doch ist die Lohnsteigetungskurve noch weiter nach unten verschoben. Die stärksten Unterschiede zwischen den realen Brutto- und Nettolohnkurven gibt es in den Jahren 1969, 1970, 1972 und 1974, in denen die Lohnsteuer je Lohnabhängigen am stärksten zunahm. Nur von 1967 auf 1968 sank die Lohnsteuerbelastung.
4 Löhne bleiben hinter Produktivität zurück
Es kann jedenfalls in den letzten sieben Jahren von einem Druck der Löhne auf die Preise keine Rede sein. In allen relevanten Aggregaten zeigt sich, daß bis einschließlich 1970 die Produktivität den Löhnen weit voraneilte (auch wieder 1972) und daß nur in zwei Jahren die Löhne stärker stiegen als die Produktivität. Diese beiden Jahre aber konnten die Asymmetrie der Verteilung in den vorangegangenen Jahren bei weitem nicht wettmachen. Dies bedeutet aber auch, daß die leichten Vorteile, die die Lohnabhängigen im Jahre 1974 (voraussichtlich) erreicht haben, mehr als berechtigt waren, da ja in den vorangegangenen Jahren der Anteil der Lohnabhängigen zurückgegangen war.
Reale Nettolohnsteigerungen (ohne Sozialabgaben)
Betrachtet man die Lohnzuwächse vom reinen Verfügungsstandpunkt aus (also: was bekommt der Lohnabhängige auf die Hand), dann müssen die Sozialabgaben anteilsmäßig für die privat Beschäftigten abgezogen werden (Spalte 6). Es zeigt sich wieder, daß 1971 und 1974 der Rückstand aus den anderen Jahren nicht aufgeholt werden konnte und die Situation der Lohnabhängigen sich, gemessen an der Produktivitätssteigerung, 1967 bis 1974 verschlechtert hat.
Wir sehen also, daß sich vollkommen verschiedene Schlußfolgerungen bezüglich der inflatorischen Rolle der Löhne im laufenden Konjunkturzyklus ziehen lassen, je nachdem, welche Größen für den Vergleich herangezogen werden. Während die Verwendung der nominellen Gesamtgrößen auf großen Lohndruck und die preistreibende Rolle der Löhne hinzuweisen scheint, sieht man bei Verwendung der richtigen Größen, die dem Lohnkostenstandpunkt entsprechen, daß von diesem Lohndruck nicht nur keine Rede sein kann, sondern daß die Lohnsteigerungen über den Konjunkturverlauf hin erheblich hinter den Produktivitätssteigerungen geblieben sind (durchschnittliche Produktivitätssteigerung, wenn man die Gesamtsteigerung 1967-74 auf die einzelnen Jahre aufteilt: 6,0 Prozent, durchschnittliche Lohnsteigerung: 4,3 Prozent). Damit ist bewiesen, daß es nicht die Löhne waren, die die Preise hochtrieben.
Für Österreich zeigt sich, daß im Konjunkturaufschwung zuerst die Produktivität den Löhnen davoneilt (1967 bis 1970). So erfolgte eine Einkommensumverteilung zum Nachteil der Lohnabhängigen. Um diese rückgängig zu machen, hätten in den folgenden Jahren höhere Lohnforderungen gestellt werden müssen. Dies gelang in Österreich nur im etwas konjunkturschwächeren Jahr 1971, dann zog die Produktivität wieder an und den Löhnen davon. Erst im Jahr 1974 ergibt sich wieder eine Annäherung der Löhne an die Produktivität, wobei jedoch der früher erreichte Vorsprung der Gewinne nicht wettgemacht wird.
5 Profitklemme 1974: der Staat gewann, nicht der Lohn
Betrachtet man jedoch die Zunahme der Bruttolöhne, die vom Standpunkt des Unternehmers deshalb wichtig sind, da er ja den Lohnabhängigen Bruttolöhne bezahlt, verbessert sich das Bild zugunsten der Löhne (durchschnittliche Lohnsteigerung: fünf Prozent); besonders 1974 hat eine kräftige Behauptung der Löhne stattgefunden. Diese kann zwar bei weitem nicht die in den Jahren bis 1970 erlittenen Nachteile ausgleichen, doch scheint das Bild etwas rosiger. Das beweist auch, daß die Entwicklung der Lohnsteuer eine große Rolle spielt. Die Verteilungsverschiebung 1974 (zu Lasten der Gewinne!) scheint zugunsten des Staates (also der Lohnsteuer) und nicht zugunsten der Lohnabhängigen vor sich gegangen zu sein.
Vom Lohn/Produktivitäts-Vergleich kann jedoch nicht eindeutig auf die Gewinnentwicklung geschlossen werden. Hier kurz einige der Gründe: [7]
- wegen Steuern: der Anteil der Lohnsteuer am „verteilbaren Produkt“ (siehe weiter unten) stieg kontinuierlich zwischen 1968 und 1974 mit nur einer kleinen Unterbrechung 1973. Aber auch die anderen Steuern und ihre Entwicklung beeinflussen den Staatsanteil, der einen „Keil“ zwischen Nettolohn- und Nettogewinnquote bildet (s. Abb. 3). Ohne Annahmen über den Staatsanteil kann daher aus dem Produktivitäts/Lohn-Vergleich nicht auf die Nertogewinnentwicklung (die für die Investitionsfinanzierung maßgeblich ist) geschlossen werden.
- wegen Preissteigerungen: nicht nur die Einkommen der Lohnabhängigen unterliegen der Preissteigerung, wie vorher gezeigt wurde, sondern auch die Einkommen des Staates, der ja auch von den Unternehmern kauft. Diese Preissteigerungen, die in die Taschen der Unternehmer fließen, wurden oben nicht berücksichtigt.
- wegen Exportentwicklung: wenn, wie im letzten Konjunkturaufschwung und besonders in den letzten Jahren, Exportsteigerungen Hand in Hand gehen mit Exportpreiserhöhungen, die über den inländischen liegen, so steigen durch diese Preiserhöhungen die Kosten der Unternehmer im Inland nicht; daher fallen diese Preiserhöhungen ganz den Gewinnen zu. Dieser Effekt kann durch einen Lohn/Produktivitäts-Vergleich auch bei Einbeziehung der Veränderungen im (inländischen) Preisniveau nicht berücksichtigt werden.
- wegen der Zunahme der Lohnabhängigen: da jeder Lohnabhängige neben seinem Lohn auch Gewinn für den Unternehmer produziert, bringt eine größere Zahl von Lohnabhängigen höheren Gewinn, wenn Produktivität und Lohnsatz gleich bleiben. Nimmt die Zahl der Unternehmer ab (oder bleibt sie unverändert), so nimmt der Gewinn pro Unternehmer zu. Dieser Effekt ist um so stärker, je stärker die Produktivität steigt (im Verhältnis zum Lohnsatz). Im Zeitraum 1967-74 stieg die Zahl der Lohnabhängigen im privaten Sektor um 11,8 Prozent, während die der Selbständigen im gleichen Zeitraum um 29 Prozent (ohne Landwirtschaft um 19 Prozent) zurückging. Der beschriebene Effekt war also sehr ausgeprägt.
- wegen Produktivitätsmessung: für die obigen Vergleiche wurde die gesamtwirtschaftliche Produktivität, aber die privaten Löhne verwendet. Dadurch wurde das Nachhinken der Löhne im Aufschwung untertrieben, da die privatwirtschaftliche Produktivität im Aufschwung stärker ansteigt als die gesamtwirtschaftliche (Industrieproduktivität, Tab. 1, Sp. 1a).
- wegen der Definition der Gewinne in der Statistik: nach der österreichischen Volkseinkommensrechnung werden die Nicht-Lohneinkommen (außer den Einkommen des Staates aus Besitz und Unternehmung) als „Gesamtgewinne“ bezeichnet. [8] In dieser Größe verbergen sich die Selbständigeneinkommen aus Land- und Forstwirtschaft (L&F), die zum größten Teil nicht als Unternehmereinkommen bezeichnet werden können, weiters die Einkommen aus Gewerbebetrieb, aus freiem Beruf, aus Besitz (Vermietung, Verpachtung usw.), die unverteilten Gewinne der Kapitalgesellschaften und die „Statistische Korrektur“. Profite im engeren Sinn sind hievon die unverteilten Gewinne, Teile der Einkommen aus Gewerbeberrieb, freien Berufen und Besitz sowie kleine Teile der landwirtschaftlichen Einkommen. Durch die Vermengung dieser sehr heterogenen Einkommensgruppen, die zwar seit Jahren beklagt, [9] aber nicht behoben wird, leitet man die Unmöglichkeit ab, Verteilungsanalysen durchzuführen. Trotz der fehlenden Homogenität des Aggregates Gewinneinkommen muß hier jedoch besonders auf den wesentlichen Unterschied zwischen Lohn- und Nicht-Lohneinkommen hingewiesen werden. Direkte Schlüsse von der Lohn/Produktivitäts-Rechnung auf die Profite sind daher nur sehr beschränkt anstellbar.
Ab und zu wird eingewendet, daß die Nicht-Lohneinkommen aus folgenden Gründen stark steigen: kräftige Zunahme der Einkommen einiger weniger Selbständigengruppen, der Sparzinsen durch erhöhtes Sparvolumen und der Mieten durch Vergrößerung des Prozentsatzes nicht mietergeschützter Wohnungen bzw. frei vereinbarter Mietzinse; es seien hauptsächlich, wenn nicht vollständig, diese Faktoren, welche die Nicht-Lohneinkommen steigen ließen, während die tatsächlichen Profite (hauptsächlich in der Industrie) eher rückläufig oder unverändert wären. Wenn auch die Einzelbehauptungen zutreffen, so ist ihr Ausmaß jedoch nie eindeutig bestimmt worden. Es muß bezweifelt werden, daß die überaus starke Steigerung der Nicht-Lohneinkommen ausschließlich oder auch nur hauptsächlich auf diese Faktoren zurückzuführen ist.
6 Das Profit-Versteckspiel
Wie verteilt sich das „Einkommen“ bzw. das „verteilbare Produkt“ auf Löhne, Gewinne und Staatsanteil? [10] Welcher Anteil hat sich im letzten Konjunkturzyklus auf Kosten welchen anderen Anteils verändert? Haben die Lohnabhängigen die „Verteilungsfrage“ gestellt oder nicht?
Außerdem: welche Folgen hat die Verwendung von bestimmten Verteilungsmaßen auf die Analyse? Üblicherweise wird als „Kuchen, der zur Verteilung zur Verfügung steht“, die statistische Größe „Volkseinkommen“ herangezogen, die sich als Summe der Bruttoeinkommen (also inklusive direkter Steuern) der Faktoren Arbeit und Kapital errechnet: Diese Summe entspricht gleichzeitig dem „Nettosozialprodukt zu Faktorkosten“, also der gesamten Produktion einer Volkswirtschaft (inklusive der „Produktion“ des öffentlichen Sektors), abzüglich der Abschreibungen und indirekten Steuern. Entscheidend für die Verteilung ist jedoch die Summe dessen, was für Konsum und Investition (Nettoinvestition) ausgegeben werden kann. Der Unterschied zwischen dieser Größe und dem „Volkseinkommen“ liegt bei den indirekten Steuern, die ja der Staat zu Konsum oder Investition verwendet. Werden also die indirekten Steuern dem Volkseinkommen zugeschlagen (= Nettosozialprodukt zu Marktpreisen), muß dann noch jener Teil abgezogen werden, der an den öffentlichen Sektor als Lohneinkommen ausbezahlt wird, da sonst Doppelzählungen das Bild verzerren.
Als „verteilbares Produkt“ wird also im weiteren die Summe aus folgenden Größen der Volkseinkommensrechnung bezeichnet: private Nettolöhne und Nettogewinne plus Steuern und Sozialabgaben, oder: alle Nettolöhne und Nettogewinne plus alle Steuern abzüglich staatliche Löhne, oder: Volkseinkommen plus indirekte Steuern minus staatliche Löhne, oder: Nettosozialprodukt zu Marktpreisen minus staatliche Löhne. Man kann diese Summe (das verteilbare Produkt) auf mehrere Arten bilden, weil die Volkseinkommensrechnung das Sozialprodukt sowohl von der Entstehungsseite (= Produktion) als auch von der Verwendungsseite (= Konsum, Investitionen) und von der Verteilungsseite (= Einkommen der Produktionsfaktoren) berechnet und theoretisch die Summen bei allen drei Methoden gleich sind.
Da in der österreichischen Volkseinkommensrechnung die Profite im eigentlichen Sinn nicht ausgewiesen sind und auch die Summe der Bilanzgewinne nicht verfügbar ist, muß man sich zur Analyse mit der Position „Einkommen aus Besitz und Unternehmung“ (abgekürzt: EB&U) begnügen. Einerseits ist in dieser Position nur ein Teil der Gewinne enthalten, andererseits enthält sie Größen, die keine Gewinne darstellen. Mangels anderer statistischer Größen werden hier im weiteren die Einkommen aus Besitz und Unternehmung (EB&U) als „Bruttogewinne“ bezeichnet. [11] Davon werden dann die Gewinnsteuern abgezogen, d.s. die veranlagte Einkommensteuer, die Körperschaftsteuer, die Gewerbesteuer, die Vermögensteuer, jeweils mit den dazugehörigen prozentualen Aufschlägen, und die Beiträge zur Sozialversicherung der Selbständigen, um so die Nettogewinne zu errechnen.
Es ist klar, daß die oben genannten Steuern nicht alle direkten Steuern auf Nicht-Lohneinkommen umfassen, doch schließen sie weit über drei Viertel ein. Bei den Gewinnsteuern handelt es sich um die kassenmäßig eingegangenen Steuern des jeweiligen Jahres und nicht um die Steuerschuld. Bei der veranlagten Einkommensteuer und Körperschaftsteuer weichen Steuerschuld und die kassenmäßig eingegangenen Beträge insoferne ab, als die letzteren aus den Vorauszahlungen für das laufende Jahr und den Nachzahlungen der in den letzten Jahren zuwenig bezahlten Steuern bestehen. Besonders in Konjunkturaufschwüngen ist die Steuerschuld wesentlich größer als die (auf der Konjunktur- und Gewinnsituation vergangener Jahre beruhenden) Kasseneingänge. Als Nettolöhne gelten die Brutto-Lohn- und Gehaltsumme der privaten Lohnabhängigen, abzüglich der Lohnsteuer (= Nettolöhne inklusive Sozialabgaben). Wenn davon die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung abgezogen werden, erhält man die Nettolöhne ohne Sozialabgaben.
Die zur jeweils ausgewiesenen Lohnquote passende Gewinnquote ergibt sich aus der Differenz (hundert minus Lohnquote), da im Nenner jeweils Löhne und Gewinne nach verschiedenen Definitionen stehen. Dies gilt auch für Tabelle 3 und Abb. 2. Es handelt sich also hier nur um die Lohn- und Gewinnrelation, ohne Rücksicht auf den Staatsanteil, von dem jetzt abstrahiert wird.
7 Profite treiben die Preise hoch
Übliche Lohnquote:
sämtliche Bruttolöhne aller Lohnabhängigen durch Volkseinkommen (Spalte 1, Kurve 1 in Tabelle 3/Abb. 2). Die Daten zeigen, daß der Gewinnanteil von 1967 auf 1968 konstant blieb, sich dann bis 1970 stark erhöhte, 1971 unter den Anteil von 1967 zurückfiel, sich in den nächsten beiden Jahren wieder verbesserte und erst 1974 stark abnahm: Bei den Daten für 1973 sind die den Unternehmern bei Einführung der Mehrwertsteuer (Anfang 1974) als Vorratsentlastung gutgeschriebenen 7% Milliarden Schilling im Gewinn enthalten (und auch im Volkseinkommen). Auch wenn diese Summe rein technisch (von der Volkseinkommensrechnung her) nicht zu den Gewinnen zu zählen sein sollte, hat sie doch den Liquiditätsspielraum für Investitionszwecke erhöht, muß daher im Sinne dieser Untersuchung einbezogen werden.
Wenn nur das Anfangs- und (vorläufige) Endjahr der Betrachtung verglichen werden, ergibt sich über den bisherigen Konjunkturverlauf eine Verringerung des Gewinnanteils von zwei Prozentpunkten. Es zeigt sich, daß die Inflationsstöße 1970 und 1972 (um vom Jahr 1973 wegen der „Ölkrise“ und der Mehrwertsteuereinführung abzusehen) jeweils mit den Jahren einer Ausweitung der Gewinnanteile zusammenfallen. Man könnte jedoch argumentieren, daß besonders 1971 sich die Ertragssituation der Unternehmer stark verschlechtert hätte (der Gewinnanteil sank unter den von 1967), so daß 1972 die Preise erhöht werden mußten, um zumindest wieder diesen Anteil zu erreichen. Der Preisstoß 1970 kann jedoch nicht mit der Rückgewinnung verlorener Einkommensanteile seitens der Unternehmer erklärt werden, da ja der Anteil 1969 über dem von 1967 lag. Für den Preissprung 1974 zeigt sich, daß die Lohnabhängigen ihre Anteilsverluste während der zwei vorangegangenen Jahre erkannt hatten und erfolgreich die Verteilungsfrage stellten. Zusammenfassend ergibt sich folgendes Bild: während des laufenden Konjunkturzyklus gelang es den Unternehmern zweimal, den Lohnabhängigen nur einmal, erfolgreich die Verteilungsfrage zu stellen. Die Folge waren jedesmal sich verstärkende Inflationsstöße. Von einer Lohn/Preis-Spirale kann man höchstens 1974 sprechen, sonst eher von einer Gewinn/Preis-Spirale. [12]
Private Bruttolohnquote:
Sehr ähnlich ist das Bild, wenn man die staatlichen Löhne in Zähler und Nenner ausschaltet. Spalte 2 zeigt die „private Bruttolohnquote“, als Quotient von privaten Bruttolöhnen durch die Summe von diesen plus Bruttogewinnen. Bis 1970 gewinnen die Unternehmeranteile etwas stärker als vorher, ab 1971 steigt der Lohnanteil stärker (bzw. sinkt weniger) als vorhin. Vom Niveau her liegt der Gewinnanteil hier um durchschnittlich fünf bis sechs Prozentpunkte höher. Weiterhin gilt: 1971 waren die Gewinne unter starkem Lohndruck, in den nächsten beiden Jahren jedoch konnten sie diesen mehr als ausgleichen.
Schaltet man nun im Nenner die Gewinnsteuern aus, erhält man jenen Anteil am „verteilbaren Produkt“, der einerseits die gesamten Lohnkosten, andererseits die für die Investitionsfinanzierung maßgeblichen Nettogewinne enthält (Spalte 3). Diese Quoten spiegeln die Belastung der Gewinne durch die mit den Löhnen verbundenen Kosten besser wider als die vorigen Quoten. Im Niveau liegen diese Quoten leicht über dem Niveau von Spalte 1, d.h. die Nettogewinnanteile liegen leicht unter den Bruttogewinnanteilen. Im Verlauf dieser Quoten zeigt sich: die Nettogewinnquote steigt 1968-70 stärker als die Bruttogewinnquote, sinkt 1971 weniger als diese und steigt dann bis 1973 wesentlich stärker. Der Nettogewinnanteil 1971 liegt nur wenig unter dem von 1967.
Schaltet man nun die Lohnsteuern aus, erhält man die private Nettogewinn- und Nettolohnquote (mit Sozialabgaben), Spalte 4. Man erhält jenen Anteil, der einerseits die Aufwendungen für die Lohnabhängigen erfaßt, andererseits das, was der Kapitalseite netto verbleibt. Der Anteil, den sich der Staat durch die Lohnsteuer sichert, ist ausgeklammert, Lohn- und Steuerpolitik sind voneinander getrennt. Was sich in den Quoten 2 und 3 ankündigte, setzt sich hier weiter fort: die Gewinnquoten steigen stärker bzw. sinken weniger als vorher. Interessant ist die Gewinnquote 1971, die genau der von 1967 entspricht. Das bedeutet aber, daß die Gewinne 1971 unter keinem sehr starken Lohndruck waren. Daher können die Anteilssteigerungen 1972 und 1973 nicht mehr mit dem Aufholenmüssen aus der Vorperiode erklärt werden.
Schaltet man schließlich in Zähler und Nenner noch die Sozialabgaben aus den Nettolöhnen aus, geht man also zum reinen Lohnverfügungsstandpunkt über (Spalte 5), dann ist bis auf 1974 die Lohnquote in jedem Jahr niedriger als 1967. Von der Lohn/Preis-Spirale bleibt nichts mehr übrig.
Diese Übersicht, in Zusammenhang mit Tabelle 1 und Abb. 2, zeigt wieder einmal, welche Konsequenzen es hat, ob man die eine oder die andere Statistik verwendet. Dem Standpunkt der Lohn/Preis-Spirale- Argumentation kommt am ehesten die in Spalte 4 ausgewiesene Quote nahe. Die üblicherweise verwendeten Quoten (besonders 1) verzerren das tatsächliche Bild insofern, als sie die Entwicklung der Gewinnanteile weit negativer zeichnen, als sie tatsächlich war.
8 Gewinne und Steuern bilden Schranke für Löhne
Im folgenden soll nun die Entwicklung des gesamten „verteilbaren Produkts“ untersucht werden, d.h. auch der Staatsanteil wird in die Verteilungsanalyse einbezogen. Wir sind ja hauptsächlich am Phänomen der „Lohn/Preis-Spirale“ interessiert, wir fragen also, wie sich am Ende jeder Periode der feststellbare Preis des verteilbaren Produkts aufteilt in Löhne, Gewinne und Staatsanteil.
In Abbildung 3 werden die Lohnanteile von unten, die Gewinnanteile von oben aufgetragen. Dazwischen liegt der Staatsanteil. Die hier abgebildeten Kurven schwanken weniger als die in Abb. 2. Das liegt daran, daß der Nenner der einzelnen Quoten hier um den Staatsanteil vergrößert ist. Der Verlauf der Kurven ist ähnlich wie in Abb. 2. Es zeigt sich aber ein sehr wichtiger Unterschied: die Lohnquote 1974 liegt (netto) nur ganz wenig über der von 1967, während der Gewinnanteil (netto) um mehr als zwei Prozentpunkte unter dem von 1967 liegt. Die Lösung liegt darin, daß sich der Staatsanteil stark vergrößert hat (inklusive Lohn- und Gewinnsteuern von 1973 auf 1974 um 2½ Prozentpunkte). Wie vorher zeigen die Bruttolöhne eine stärkere Steigerung als die Nettolöhne, während sich Brutto- und Nettogewinnanteile ziemlich parallel verhalten.
Der Nettolohnanteil sank zwischen 1967 und 1970 (mit und ohne Sozialabgaben, dasselbe gilt für den Bruttolohnanteil), 1971 stieg er leicht (allerdings ohne das Niveau 1967 zu erreichen), ging 1972 wieder ein wenig zurück und stieg 1973 und 1974 praktisch auf das Niveau von 1967. Inklusive Lohnsteuer wurde 1971 fast das Niveau von 1967 erreicht, ebenso 1973, während dieses Niveau 1974 überschritten wurde. Wenn man an die Lohnsteuerreformen 1969, 1971 und 1973 denkt, zeigt sich, daß nur im Jahr 1973 der Anteil der Lohnsteuer am verteilbaren Produkt gegenüber dem Vorjahr zurückging, während er sonst kontinuierlich anstieg. Im Jahr 1974 hatte der Lohnsteueranteil seinen bisher höchsten Stand erreicht (4,2 Prozent des verteilbaren Produkts).
Im Gegensatz zu den obigen Darstellungen ging der Nettogewinnanteil von 1967 auf 1968 leicht zurück, sank dann 1971 unter den Wert von 1967 und erreichte dieses Niveau auch im nächsten Jahr noch nicht, sondern erst wieder 1973, um dann 1974 stark unter das Niveau von 1967 zurückzufallen.
Steigende Nettogewinn- und -lohnquoten gab es im Jahr 1973, fallende Gewinn- und Lohnquoten im Jahre 1968. Dies konnte natürlich in der Darstellung früher nicht sichtbar werden, da der Staatsanteil, der hier den Keil zwischen Löhnen und Gewinnen bildet, nicht ausgewiesen war. Es zeigt sich also bei differenzierterer Darstellung der Einkommensanteile, daß steigende Lohn- und Gewinnquoten ebenso miteinander vereinbar sind wie fallende. Die Lohn- und Gewinnquoten müssen sich also nicht immer in entgegengesetzten Richtungen bewegen (wegen des Staatsanteils). In solchen Fällen spielt sich der Verteilungskampf nicht zwischen Unternehmern und Lohnabhängigen, sondern zwischen Staat und privatem Sektor ab.
Für die Lohn/Preis-Spirale ergibt sich aus dieser Darstellung: Da der Lohnanteil bis 1970 kontinuierlich sank, war der Nachholbedarf 1971 sehr groß, wollte man wenigstens eine leichte Verteilungskorrektur durchführen. Dies gelang auch, doch fiel der Gewinnanteil stärker, als der Lohnanteil zunahm, wofür sich die Gewinne dann in den nächsten beiden Jahren kräftig revanchierten. 1972 gelang dies auf Kosten der Löhne, 1973 auf Kosten des Staatsanteils (Mehrwertsteuereinführung, Vorratsentlastung usw.). Das bedeutet aber, daß es 1973, da ja der Gewinnanteil stieg, zu keiner Verschlechterung der Investitionsfinanzierung gekommen ist, ja sich die Finanzierungssituation sogar verbessert hat.
Die Unternehmer kommentieren eine solche Entwicklung immer damit, daß eine „gute Ertragslage“ eben zur Investitionsfinanzierung, die ja Arbeitsplätze schaffe und erhalte, notwendig sei. Von ihrem Standpunkt aus haben sie recht: es muß möglichst viel investiert werden, um in der heimischen und der internationalen Konkurrenz einen Vorsprung entweder zu erreichen oder zu halten. Mit dieser Argumentation aber kann jede Lohnerhöhung als preistreibend angeprangert werden, da ja eine Gefahr für die Erträge entstehen könnte. Dann handelt es sich um Absicherung jeder Profitsteigerung. Wenn man wirklich so denkt, soll man es auch offen sagen. — Das geschieht jedoch sehr selten: meist wird „Erhaltung der Arbeitsplätze“ als Argument für die Notwendigkeit von steigenden Profiten vorgeschoben, oder andere arbeitnehmerfreundliche Gründe.
In diesem Zusammenhang ist auch die Aussage der gewiß unverdächtigen OECD [13] interessant, die die österreichische Investitionsquote als extrem hoch bezeichnet und ihre weitere Ausweitung als große Gefahr für die Inflationsbekämpfung hinstellt (s. Tab. 4).
9 Gewinne wuchsen doppelt so stark wie Löhne!
Wir weisen noch auf einen weiteren beliebten Trick hin: häufig wird der Vergleich von Lohn- oder Gewinnquoten zweier willkürlich gewählter Jahre (sage 1967 und 1974) dazu benutzt, um Schlüsse über die Veränderung oder Nichtveränderung der Einkommensverteilung zwischen diesen Zeitpunkten zu ziehen. Im konkreten Fall würde dies bedeuten, daß sich die Verteilung gegenüber 1967 zum Vorteil der Lohnabhängigen verschoben hat, da ja die Lohnquote 1974 leicht höher als 1967 liegt. Dieser Schluß ist jedoch absolut unzulässig, denn wie Abb. 2 und 3 zeigen, ist der Lohnanteil in jedem einzelnen Jahr zwischen 1967 und 1974 niedriger gewesen als in den beiden Eckjahren, während der Gewinnanteil 1969, 1970 und 1973 über dem von 1967 lag und in allen Jahren über dem von 1974. Es ging also realiter für die Lohnabhängigen etwas verloren! Bei Vergleichen der Entwicklung der Einkommensverteilung über längere Zeiträume hinweg muß daher die kumulierte Differenz betrachtet werden.
Wenn wir nun von der Lohn/Preis-Argumentation weggehen und uns dem tatsächlichen Anteil von Löhnen und Gewinnen am Gesamtprodukt zuwenden, dann muß auch die steigende Zahl der Lohnabhängigen und die fallende Zahl der selbständig Erwerbstätigen in die Rechnung einbezogen werden. Dies kann auf zweierlei Art geschehen: entweder man berechnet eine sogenannte „bereinigte“ Lohnquote, in der ein Bereinigungsverfahren den steigenden Anteil der Unselbständigen an den gesamten Erwerbstätigen einbezieht, oder man stellt die Entwicklung von Löhnen und Gewinnen pro Kopf für den erwähnten Zeitablauf dar. Tabelle 5 zeigt diese Berechnungen. Da die Zahl der selbständig Erwerbstätigen von rund 780.000 im Jahre 1967 auf rund 540.000 in 1974 zurückging, die aller Lohnabhängigen aber von 2,4 Millionen auf 2,7 Millionen anstieg, zeigt die Entwicklung der bereinigten Lohnquote einen ganz anderen Verlauf als die der unbereinigten (siehe Kurven 1 und 6 in Abb. 2 bzw. Spalte 1 in Tabelle 3 und Spalte 1 in Tabelle 5).
Die bereinigte Lohnquote fällt bis 1970, steigt dann 1971 leicht, erreicht jedoch bei weitem nicht den Wert von 1967, fällt dann wieder zwei Jahre und steigt 1974 leicht an, liegt jedoch auch in diesem Jahr mehr als drei Prozentpunkte unter dem Wert von 1967. Die Pro-Kopf-Verteilung hat sich also seit 1967 sehr deutlich von den Löhnen zu den Gewinnen verschoben. Dies zeigt sich noch klarer bei Betrachtung der Wachstumsraten der Pro-Kopf-Löhne und -Gewinne (Spalten 2 bis 5 in Tabelle 5). Bis auf die Jahre 1971 und 1974 wuchsen die Pro-Kopf-Gewinne jeweils weit stärker als die Pro-Kopf-Löhne (sowohl brutto als auch netto). Diese Unterschiede in den Wachstumsraten summieren sich bei den Nettogrößen zu einem eklatanten Wachstumsunterschied: Während die Pro-Kopf-Gewinne über den gesamten Zeitraum 1967-74 um mehr als 200 Prozent stiegen, erreichten die Pro-Kopf-Löhne in dieser Zeit nur eine Steigerung von 95 Prozent. Also: Die Gewinnsteigerung war mehr als doppelt so groß wie die Lohnsteigerung!
Figaro, Wien, 9. November 1878
10 Widerlegung der gängigsten Vorurteile
Als Fazit dieser Untersuchung treten wir einigen weit verbreiteten Vorurteilen mit folgenden Antworten entgegen:
„Die Löhne treiben die Preise hoch“
Das im Bild von der Lohn/Preis-Spirale veranschaulichte Vorurteil, daß die Löhne die Preise treiben, wurde als Propagandainstrument der Unternehmer entlarvt, das immer dann eingesetzt wird, wenn die Lohnabhängigen versuchen, die im Konjunkturaufschwung zu ihren Ungunsten verschobene Einkommensverteilung wieder zu korrigieren.
„Der Großteil der Teuerung der letzten Jahre ist importiert“
Die Inflationsschübe 1970 und 1972 sind zum großen Teil darauf zurückzuführen, daß die Unternehmer zur Ausweitung oder Sicherstellung ihrer Gewinnanteile die Preise erhöhten. Dies ist also ein rein inländischer Inflationsbeitrag. Der Schub 1973 geht sicher zu einem Teil auf Konto der gestiegenen Rohstoffpreise, aber auch auf Konto einer Steigerung der Gewinn- und Lohnanteile, wobei im Gewinn/Lohn-Vergleich der Gewinnanteil stärker stieg (Mehrwertsteuersprung, Vorratsentlastung).
„Die Lohn/Preis-Spirale existiert (sprich: ist im ganzen Konjunkturzyklus wirksam)“
Nur im Jahr 1974 trifft das Bild von der Lohn/Preis-Spirale tatsächlich zu. Bedingt durch den Arbeitskräftemangel gelang es den Lohnabhängigen, den Lohnanteil auf Kosten des Gewinnanteils zu vergrößern, um halbwegs — wenn auch nur sehr unvollständig — das in den vorangegangenen Jahren verlorene Terrain wettzumachen. Eine weitere Beschleunigung des inländischen Preisanstiegs hätte vermieden werden können, wenn die Unternehmer nicht ihre gestiegenen Gewinnanteile zu halten getrachtet hätten.
„Die Lohnerhöhungen fressen die Gewinne auf“
Im letzten Konjunkturzyklus hat sich bisher die Lage des einzelnen Lohnabhängigen relativ zu der des einzelnen „Selbständigen“ gewaltig verschlechtert. Obwohl beide Gruppen ihr Realeinkommen vergrößern konnten, wuchs das der Selbständigen mehr als doppelt so rasch wie das der „Unselbständigen“.
„Die Arbeiter bekommen mehr, als ihnen aufgrund der Produktivitätsentwicklung zusteht“
Das starke Produktivitätswachstum des letzten Konjunkturzyklus, durchschnittlich sechs Prozent, wurde nur zu einem geringen Teil in Einkommenszuwächse der Lohnabhängigen umgewandelt, da die Nettolöhne je privatem Lohnabhängigen nur um rund vier Prozent jährlich (real) stiegen. Bei gleich starkem Wachstum von Löhnen und Gewinnen im Ausmaß der Produktivität wären stabile Preise, zumindest im heimischen Sektor, bzw. Preissteigerungen im Ausmaß des Jahres 1967 (vier Prozent) möglich gewesen. Da aber die Produktivität durchschnittlich um zwei Prozentpunkte stärker stieg als die Löhne, wäre es möglich gewesen, die Preissteigerungsrate herabzudrücken, sogar ohne den Gewinnanteil zu verringern! Im Gegensatz hiezu haben sich jedoch die Preisssteigerungsraten kräftig beschleunigt und ist auch der Gewinnanteil fast durchlaufend gestiegen. Die Verantwortung für die Preisbeschleunigung innerhalb des laufenden Konjunkturzyklus kann also auf keinen Fall den Lohnabhängigen angelastet werden. Diese Aussage wird nur vom Jahr 1974 durchbrochen, in dem die Lohnabhängigen erfolgreich einen kleinen Schritt in Richtung Wiederherstellung des Verteilungsgleichgewichts getan haben.
[1] Aike Blechschmidt: Löhne, Preise und Gewinne (1967-73). Materialien zur Lohn/Preis-Spirale und Inflation, Lampertheim 1974
[2] Der Verbraucherpreisindex (VPI) hat natürlich als Inflationsindikator gewisse Schwächen (was auch auf andere Größen zutrifft). Doch darf man aus dem VPI auch nicht mehr herauslesen wollen, als in ihm steckt: es ist klar, daß für einzelne private Haushalte oder verschiedene soziale Schichten die von ihnen verzeichneten Preissteigerungen von denen des VPI abweichen, da der VPI eine konstante Konsumstruktur unterstellt, die eben verschieden von der des Einzelhaushaltes ist, weil sie auf einem Durchschnitt beruht.
Alternative Maße zur Inflationsmessung, jedoch auch mit Mängeln behaftet, sind die implizite Preissteigerungsrate (= Deflator) des privaten Konsums oder der Deflator des Bruttonationalprodukts (siehe Tabelle 2).
[3] Österreichs Volkseinkommen 1972 und 1973. Österr. Statistisches Zentralamt 1974, S. 4
[3a] „Private“ und „öffentliche“ Löhne: Mit „privaten“ Löhnen sind die Löhne im privaten Sektor gemeint, mit „öffentlichen“ die im öffentlichen Sektor (Staat, Länder, Gemeinden). Die Definition des öffentlichen Sektors folgt der sogenannten „Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung“ (VGR), nach Richtlinien der UNO und der OECD (für Österreich werden die Berechnungen in den vom Statistischen Zentralamt herausgegebenen Österreichs Volkseinkommen veröffentlicht).
[4] Österreichs Volkseinkommen 1954 bis 1968. Wien 1971, S. 29f
[5] Eine Annäherung an die Entwicklung der privaten Produktivität ist durch die Produktivitätsentwicklung in der Industrie gegeben (siehe Tabelle 1, Spalte 1a).
[6] Monatsberichte des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (MB/WIFO) 3,1972
[7] Vgl. Blechschmidt, a.a.O., S. 71ff
[8] Siehe z.B. Österreichs Volkseinkommen 1972 und 1973. S. 17
[9] In allen Heften von Österreichs Volkseinkonmen. z.B. 1954 bis 1968, S. 33
[10] Siehe dazu auch G. Chaloupek: Wer verdient wieviel? NEUES FORVM September/Oktober 1972, S. 32-38. — E. Matzner: Die Einkommensumverteilung, in: C. A. Andreae (ed.): Handbuch der Österreichischen Finanzwirtschaft, Innsbruck 1970. — G. Chaloupek/H. Ostleitner: Einkommensverteilung und Verteilungspolitik in Österreich, in: H. Fischer (ed.): Das politische System Österreichs, Wien 1974. — E. Merth: Steuerlast ist ungleich verteilt, Arbeit und Wirtschaft, Mai 1974
[11] Zur Bezeichnung „Gewinne“ für die Einkommen aus B&U, die oft kritisiert wird, siehe z.B. Österreichs Volkseinkommen 1972 und 1973. S. 17
[12] Zu den Auswirkungen der Mehrwertsteuereinführung 1973 auf die Preise und Gewinne siehe K. Bayer/St. Schulmeister: Importpreise, Inflation und Einkommensverteilung, in: Die Zukunft, Heft 11, Anfang Juni 1974, S. 21
[13] „Österreich“, OECD, Paris 1974, z.B. S. 28: „Die anhaltende Verschiebung der Einkommensverteilung zugunsten der Gewinne, eine Begleiterscheinung der anhaltenden Hochkonjunktur …“; oder S. 61: „Bei einer anhaltenden Belebung der Investitionstätigkeit der Wirtschaft sollten sich die zuständigen Stellen … darauf einrichten, die 1974 eingeführten Sonderabschreibungen aufzuheben, bzw. die für 1975 vorgesehene Lohnsteuersenkung zu verschieben“.