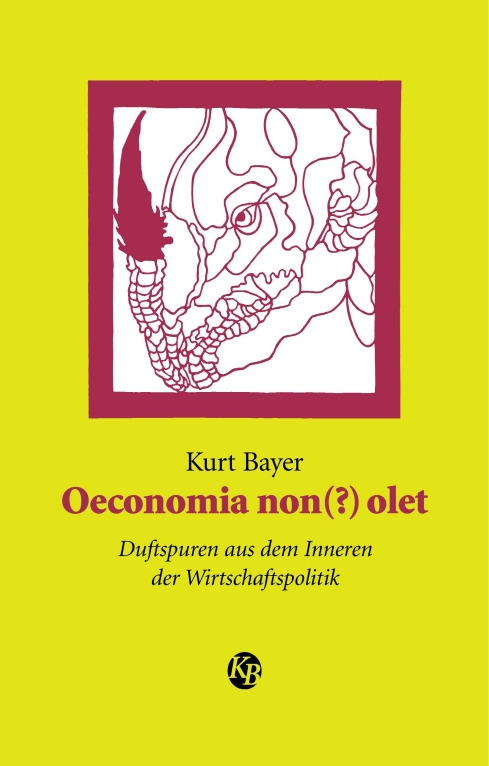(veröffentlicht in der Zeitschrift “International” 1/2019)
Die Prognosen: Wachstumsabschwächung mit weiteren Risiken nach unten
Die Expansion der Weltwirtschaft, mit der die durch die Finanz- und Wirtschaftskrise 2007 ff. verursachte, das Weiterbestehen des Kapitalismus bedrohende Wachstumsschwäche überwunden wurde, hat sich nunmehr abgeschwächt. Die Prognosen der internationalen Institute zeigen alle, dass sich auch zu Beginn des Jahres 2019 die Wachstumsabschwächung weiter fortgesetzt hat. Beispielgebend für diese Institutionen sagt die anlässlich des Treffens des Weltwirtschaftsforums in Davos Ende Jänner vorgelegte Revision des World Economic Outlook des Internationalen Währungsfonds (IMF), dass zwar für 2018 das Weltwirtschaftswachstum wie früher prognostiziert 3.8% betragen haben dürfte, 2019 jedoch „nur mehr“ 3.5% und 2020 3.6% betragen soll, um 0.2, bzw. 0.1 Prozentpunkte unter der Prognose aus dem Oktober 2018 (WEO 2019, S.1). Die Prognosen anderer Institute sind ganz ähnlich. Die Wachstumsabschwächung hat bereits im 2. Halbjahr 2018 begonnen und dürfte sich weiter fortsetzen.
Diese Entwicklungen sind je nach Region sehr unterschiedlich: In den Industrieländern) soll das Wachstum von 2.3% im Jahre 2018 auf 2.0% 2019 und weiter auf 1.7% im Jahr 2020 zurückgehen (davon Eurozone von 1.8% auf 1.6% und 1.7%); Deutschland wächst nur schwach wegen seiner Probleme mit der die Wirtschaft dominierenden Autoindustrie; Frankreich schwach wegen der Proteste der Gelbwesten und deren unsicheren Auswirkungen und Dauer; USA 2.5% im Jahre 2019 und 1.8% 2020 wegen des Auslaufens der Effekte der Senkung der Körperschaftsteuern und Anhebung der Notenbankzinsen; und Japan soll 2019 um 1.1% wachsen, jedoch nur 0.5% 2020).
In den Schwellen- und Entwicklungsländern soll das Wachstum sich 2019 nur ganz leicht von 4.6% auf 4.5% abschwächen, 2020 aber wieder auf 4.9% zunehmen. Dabei sollen die asiatischen Länder von 6.5% 2018 auf 6.3% 2019 und 6.4% 2020 weiterhin relativ wachstumsstark bleiben, wobei jedoch die durch die Zollstreitigkeiten und anderen Handelsprobleme Chinas mit den USA zu erwartenden Effekte unsicher, aber jedenfalls wachstumsreduzierende Auswirkungen haben werden. Lateinamerika soll sich nach dem Rezessionsjahr 2018 (1.1%) auf 2.0% 2019 und 2.5% 2020 leicht erholen, jedoch wird auch dieses Wachstum schwächer eingeschätzt als noch im Oktober, neben hausgemachten Problemen auch wegen der steigenden USA-Zinsen, die die hochverschuldeten lateinamerikanischen Länder besonders stark negativ betreffen. Im Mittleren Osten, Nordafrika , Afghanistan und Pakistan soll das Wirtschaftswachstum 2019 weiterhin mit 2.4% schwach bleiben, aber 2020 auf 3% ansteigen. In Sub-Sahara-Afrika erwartet der IMF einen Wachstumsschub von 2.9% im Jahre 2018 auf 3.5% und 3.6%, aber auch hier werden die fallenden Ölpreise für niedrigere als im letzten Herbst erwartete Ergebnisse verantwortlich gemacht. In der GUS (Gemeinschaft Unabhängiger Staaten), dem 9 Mitglieder umfassenden losen Staatenbund in der Nachfolge der Sowjetunion soll das Wirtschaftswachstum in den nächsten beiden Jahren etwa 2 ¼% betragen: die Schwäche wird mit den niedrigeren Öl- und Gaspreisen, sowie den Russlandsanktionen begründet.
Oberflächlich betrachtet sehen diese Wachstumsrückgänge, bzw. deren Prognosen nicht gravierend aus. Im allgemeinen führen die Institute die Wachstumsabschwächung weniger auf „natürliche“ Konjunkturbewegungen zurück als auf die durch die USA verursachten Spannungen im Welthandelssystem, auf die pessimistischeren Einschätzungen der Finanzmarktteilnehmer, auf die noch nicht sichtbaren Wirtschaftsprogramme einiger neuen Regierungen (u.a. Südafrika, Mexiko), mögliche weitere USA-Maßnahmen, geopolitische Spannungen im Nahen Osten und Ostasien, sowie auch Einflüsse des Klimawandels und des beobachtbaren „Rückganges des Vertrauens in bestehende Institutionen und politische Parteien“ (IMF 2019, S.6).
Ende der Fahnenstange für den herrschenden Finanzkapitalismus?
In der Realität, die von vielen der Mainstream-Wirtschaftspolitiker und Prognoseinstitute, nicht wahrgenommen werden will, dürfte sich jedoch eine radikale Zeitenwende andeuten, die das Weiterbestehen des die letzten Jahrzehnte dominierenden Finanzkapitalismus signalisieren könnte. Die sich immer stärker abzeichnende ungelöste Umwelt- und Klimakrise, die zunehmende Ungleichheit innerhalb und zwischen Ländern, und der damit einhergehende Vertrauensverlust der Bevölkerungen in die bestehenden politischen Systeme, sowie der damit in Zusammenhang stehende Zulauf zu rechtspopulistischen bis rechtsextremen autoritären Parteien und Führungsfiguren, stellen unser bestehendes Wirtschafts- und Gesellschaftssystem in Frage.
Angesichts dieser Situation sind die Politikvorschläge des IMF unbefriedigend. Sie bleiben im traditionellen neo-klassischen Paradigma stecken – und werden damit der tatsächlichen Lage nicht gerecht. Ihr Ziel ist es vor allem, die BIP-Wachstumsraten wieder zu erhöhen. Dazu verlangen sie mehr multilaterale Kooperation, um Handelskonflikte nicht über Zollschranken lösen zu wollen, und um globale Probleme wie Migration, Finanzmarktregulierung, Steuerwettbewerb und -vermeidung, Korruption anzugehen, sowie die Stärkung der globalen finanziellen Sicherheitsnetze. Angesprochen werden schon auch die Probleme des Klimawandels mit ihren verheerenden Auswirkungen auf Mensch und Wirtschaft (WEO, S.7), allerdings ohne darauf genauer einzugehen, geschweige denn Politikvorschläge zu machen. Zu den globalen Politikprioritäten kommen dann noch jene für die Einzelstaaten, die auch über die traditionellen Vorschläge wie Steigerung der Produktivität, der Teilnahme am Arbeitsmarkt für Industrieländer und dem Vorschlag für flexiblere Wechselkurse, tragfähige Schuldenpolitik und „Rationalisierung“ (sprich Reduzierung) laufender Staatsausgaben wie Gehälter der Staatsangestellten und Subventionen nicht hinausgehen . Es bleibt „More of the same“. Die einzelnen Problembereiche sind zwar richtig angesprochen, diese sind aber nur die Symptome einer sehr bedrohlichen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Problemlage.
„Weiter so“ ist eklatantes Politikversagen
Die sich derzeit abzeichnende Abschwächung des Wirtschaftswachstums ist also nicht mit einer „normalen“ Konjunkturabschwächung zu vergleichen. Diese äußert sich üblicherweise durch Kostensteigerungen, die in der Hochkonjunktur bei Löhnen, Kapitalgütern und Rohstoffpreisen durchgesetzt haben, aber letztendlich zur Investitionszurückhaltung bei Unternehmen führen. Sie bauen Lagerbestände ab und investieren höchstens in Erhaltungs-, nicht aber kapazitätserweiternde Investitionen. Ihre Umsätze sinken, die entlassen Arbeitnehmer, die Steuereinnahmen sinken, und so geht die Gesamtnachfrage zurück, die sich aus Investitions-, Konsum- und Staatsnachfrage zusammensetzt. Passiert das in mehreren Ländern, geht auch der letzte Ausweg, die Exportnachfrage zurück, und es kommt zur Rezession. Dieses vereinfachte Konjunkturbild blendet jedoch die heute dominante Rolle der Finanzmärkte aus: diese finanzieren nicht mehr nur Investitionen der Unternehmen und privaten Konsum und Staatsnachfrage, sondern haben den Finanzinvestoren, die mit Währungen, Aktien, Anleihen, Wechselkursen, Rohstoffmärkten, und allem anderen spekulieren, den bestimmenden Einfluss auf das Wirtschaftsgeschehen eingeräumt. Die Liberalisierungsschübe der späten 1980er Jahre haben die Finanzmärkte „entfesselt“, aber statt der von deren Propagandisten behaupteten durchdringenden Effizienzsteigerungen des Wirtschaftens riesige Schwankungen, Spekulationsblasen und Unsicherheiten eingebrockt. Die Finanzkrise, die 2007 in den USA mit Realitätenpreisspekulationen ausgelöst, sich über die Industrieländer auch auf viele Schwellen- und Entwicklungsländer verbreitet hat, da die Finanzinstitutionen heute internationale vernetzt sind, hat die Weltwirtschaft fast zum Erliegen gebracht. Die Irrationalität der Finanzmärkte zeigt sich an aktuellen Beispielen: trotz des gravierenden Brexit-Debakels habe sie auf die britischen Spreads kaum reagiert, sehr wohl und deutlich jedoch auf die geringen Ausgabenerhöhungen, die die (rechtspopulistische) italienische Regierung plant.
Es geht nicht mehr an, dass die Akteure auf den Finanzmärkten mit ihren „Erwartungen“ (das sind primär Profiterwartungen) die Notenbankpolitik, die Fiskalpolitik und damit die Gesellschafts- und Sozialpolitik der Welt weiter bestimmen. Erster Agendapunkt einer neuen Politik muss also ein Zurückdrängen der Finanzmärkte sein, deren Jahresumsätze mehr als 500 mal so hoch sind wie das Welt-BIP (mehr dazu weiter unten).
Zweiter grundlegender Punkt, der das bestehende Wirtschaftssystem in Frage stellt, ist die Bedrohung des Planeten, unserer Gesellschaften, durch die Umweltkrise, am plakativsten sichtbar in den wissenschaftlich fast hundertprozentig anerkannten Analysen der Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) der Vereinten Nationen. Diese verlangen in ihrem Bericht von 2018 (https://ipcc.ch) dringendst, dass der Welt-Temperaturanstieg bis 2030 auf maximal 1.5 Grad über dem Wert von 1990 beschränkt werden muss, ansonsten nicht wieder gutzumachende Schäden an Natur und Überlebensfähigkeit unseres Lebensstils eintreten werden. Viele dieser identifizierten Auswirkungen, vor allem in Bezug auf Trockenheit, Stürme und Wassermangel, finden bereits in vielen Ländern der Welt, vor allem auf der südlichen Halbkugel, aber auch im mediterranen Gebiet statt und verstärken die weltweiten Migrationsbewegungen. Zwar hat sich die Weltgemeinschaft 2015 in Paris auf diese Zielsetzungen verständigt, doch hat sich bisher weder Wirtschafts- noch Gesellschaftspolitik hinreichend dieses Problems angenommen. Der Ausstieg der USA, dem Hauptemittenten klimaschädlicher Gase, aus dem Pariser Vertrag, dem noch andere Länder (zB Brasilien) folgen, argumentiert mit der Notwendigkeit, Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze zu generieren, die durch Umweltschutzmaßnahmen behindert würden,, verschärft diese Krise. Die Versuche internationaler und einiger nationaler Institutionen, Energiesysteme auf erneuerbare Energieträger (und auch Nuklearenergie) umzustellen, sind unzureichend, umso mehr als bisher eine die Nachfrage nach klimaschädlichen und umweltbedrohenden Produkten und Dienstleistungen beschränkende Politik (Raumplanung, Verkehrssysteme, Bebauungsvorschriften, direkte Verbote schädlicher Produkte) ausbleibt. Im bestehenden Paradigma ist „der Kunde König“, also alles was Reklame und Propaganda den Konsumenten und Steuerzahlern einredet, als unverrückbar und jedenfalls nicht durch Staatseingriff lenkbar („Konsumentensouveränität“) kategorisiert ist – auch wenn es auf Kosten der Allgemeinheit geht. Wie die Hauptvertreterin des Marktparadigmas, Margaret Thatcher, so fürchterlich sagte: There is no such think as society“ . Für sie und ihre heute stärker werdenden Anhänger gibt es nur Individuen.
Der dritte Punkt, der auf das Ende des bestehenden Systems des Marktliberalismus hindeutet, ist die „soziale Frage“, explizit festgemacht an der sich dadurch massiv verschlechternden Verteilung von Einkommen und Vermögen. Dies wurde in den letzten Jahren zunehmend intensiv untersucht, und vor allem durch die weltweit Aufsehen erregt habende Veröffentlichung von Piketty‘s Buch „Kapital im 21. Jahrhundert“ akribisch mit weltweiter Datenarbeit unterlegt. Zwischen Industrieländern und den ärmsten Entwicklungsländern klaffen riesige Einkommenslücken: so beträgt etwa das pro-Kopf-Einkommen der Schweiz 81.000 $, jenes der USA 58.000$, jenes Österreichs 45.000 $, jedoch jenes des ärmsten Landes Burundi nur 290 $, von Malawi 320$, von Niger 360$. Das sind Relationen von mehr als 250:1. Auf kaufkraftbereinigt sinkt diese Lücke (zwischen Luxemburg und Liberia) nur auf 100:1. (In dieser Rechnung sind die Steueroasen wie Monaco und die Erdölstaaten des Mittleren Ostens noch gar nicht eingerechnet: diese würden diese „Lücken“ noch weiter vergrößern). Natürlich wissen wir, dass die Einbindung in des Weltwirtschafssystem in Ländern wie China, Indien, Brasilien, Vietnam und andere hunderte Millionen von Menschen aus der ärmsten Armut befreit und zum Teil sogar zu europäischen Mittelklassestandards verholfen hat. Dennoch haben sich zwischen ganz reich und ganz arm die Relationen weiter verschlechtert. Die Verelendung vieler Länder schreitet voran.
Dasselbe gilt auf für die Verhältnisse innerhalb der Industrieländern: in den meisten haben sich die Einkommensunterschiede in den letzten Jahren massiv vergrößert. Zu einem wichtigen Teil geht dies auf die Stagnation der Reallöhne über die letzten Jahrzehnte zurück, was auch im Rückgang der Lohnquote (Anteil der Löhne am Volkseinkommen) in den OECD-Ländern, der zwischen 5 und 10 Prozentpunkten zwischen 1990 und 2017 liegt, absehbar ist (Bayer 2019). Die Kluft zwischen den Einkommen der durchschnittlichen Arbeitnehmer und deren Manager ist von etwa 40:1 auf über 150:1 angestiegen, vor allem in den angelsächsischen Ländern. Diese sich verschlechternde Einkommensverteilung, die durch noch ungleichere Vermögensverteilungen mit getrieben wird, ist nicht nur ein soziales (Verarmung) und ökonomisches (unzureichende Nachfrage) Problem, sondern auch zunehmend ein politisches: der soziale Zusammenhalt geht verloren, die Polarisierung der Gesellschaften nimmt zu. Dies ist an den laufenden Protesten der „Gelbwesten“ in Frankreich, den zunehmenden Streiks, vor allem aber am Zulauf zu rechtspopulistischen Parteien und Führungsfiguren (Trump, UKIP, AfD in Deutschland, FPÖ in Österreich, Lega in Italien, Schwedendemokraten, Vlaams Block, und anderen in Ungarn, Polen, Dänemark, Belgien) ablesbar. Damit hat auch „der Westen“ ein massives Systemproblem, da den bestehenden Mittelparteien des Mainstream offenbar die Lösung der massiven Sozial- und Umweltprobleme nicht (mehr) zugetraut wird. Die von den Rechtspopulisten angebotenen „einfachen“ Lösungen, die primär in Abschottung, Nationalismus, plebiszitären Entscheidungsfindungen und Polarisierung bestehen, tragen nur wenig zu den angesprochenen Problemlagen bei.
Finanzmarkt treibt Kurzfristigkeit des Unternehmenskalküls
Börsennotierte Wirtschaftsunternehmen werden heute unter dem Diktat des „Shareholder Value“ betrieben. Danach ist die (fast) einzige Aufgabe des Unternehmens, den Kapitaleignern möglichst hohe Gewinne zu ermöglichen. Da diese tagtäglich die Möglichkeit haben, ihr Kapital anderswo einzusetzen, es also aus dem Unternehmen abzuziehen, steht das Management unter Druck, jederzeit einen möglichst hohen Börsenwert sicherzustellen. Da der Wert der Unternehmensbeteiligung aber nicht nur im Börsenwert ablesbar ist, sondern auch an möglichst hohen Dividendenzahlungen, schütten Manager eher Dividenden aus als in Realkapital zu investieren oder die Löhne zu erhöhen. Dies führt dazu, dass oft nur kurzfristige Maximierungskonzepte durchgeführt werden, anstatt auf die langfristige Steigerung des Unternehmenswertes hinzusteuern. Darüber hinaus wird, um das materielle Interesse der Manager mit jenem der Kapitaleigner möglichst zu verschränken (Manager haben gegenüber nicht vor Ort befindlichen Eigentümern einen großen Informationsvorsprung) ein Großteil der Managerentlohnung über „erfolgsgetriebene“ Boni, Aktienoptionen und andere variable Gehaltsbestandteile durchgeführt. Dadurch haben die Manager aber auch den Anreiz, besonders zum jeweiligen Erfolgsmessungszeitpunkt oder zum vereinbarten Zeitpunkt der Einlösung der Optionen den Unternehmenswert auch künstlich hochzutreiben – oft nicht zum Vorteil des langfristigen Unternehmenswerts.
Plädoyers über die Ablösung der Shareholder-Value-Ideologie zugunsten der Optimierung eines „Stakeholder Value“ nehmen zu (u.a. Brennan 2019). Dabei geht es darum, die Interessen aller am Unternehmen Interessierten zufriedenzustellen: die Kapitaleigner, die Arbeitskräfte, die Vorlieferanten und Abnehmer, vor allem aber auch das gesellschaftliche Umfeld, also die „Community“, deren Wohl und Wehe auch von jenem des Unternehmens abhängig ist. Solche Forderungen mögen rückwärtsgewandt klingen, da sie oft an die Eigentümer/Manager früherer Jahrzehnte erinnern, die sich an einem solchen Stakeholder Value orientiert haben. Auch genossenschaftliche Organisationsformen als Alternative zum börsennotierten Unternehmen haben grundsätzlich mehr Stakeholder-Orientierung. Erhöhungen der Fixanteile an der Entlohnung der Manager, und überhaupt eine Überprüfung der Höhe der Managergehälter, wären kleine Schritte auf dem Weg zu langfrstigerer Unternehmensorientierung.
Kleine und mittlere Unternehmen, die nicht börsennotiert sind, deren Fremdfinanzierung weitgehend von traditionellen Geschäftsbanken kommt, sind weniger den (hohen) Renditeerfordernissen der Finanzmärkte ausgesetzt (man erinnere sich an die Forderung des früheren Geschäftsführers der Deutschen Bank, Ackermann, der mindestens 15% Rendite als Ziel vorgab), und können durch langfristigere Finanzierung und individuelle Verhandlung mit dem Kreditgeber auch besser längerfristige Überlegungen anstellen, darunter auch den notwendigen Aufbau von Unternehmens-Knowhow durch langfristige Arbeitsverträge, Ausbildungsgänge und natürlich bessere Bezahlung der Arbeitskräfte.
Global Governance-Demise
Eine florierende Weltwirtschaft und -gesellschaft benötigt Kooperation, gemeinsame Problembewältigung, vor allem bei globalen Problemen, wie Klimawandel, Migration, Bekämpfung der Steuervermeidung, Korruption, kriminellen Aktivitäten, aber auch Stabilisierung der Finanzmärkte. Dazu sind in den letzten 80 Jahren eine Vielzahl von Globalen Institutionen entstanden, von der Welthandelsorganisation (WTO), dem Internationalen Währungsfonds (IMF), der Weltbank und anderen Entwicklungsbanken, spezialisierten UNO-Organisationen, und vielen anderen. Die derzeitige Entwicklung lässt die Kooperationsbereitschaft stark sinken (Bayer 2019). Die Welt steuert auf einen vermeintlichen Handelskrieg zwischen den USA und China zu, wobei sich dahinter aber viel stärker ein Machtkampf um die Hegemonie in der Weltwirtschaft verbirgt. Die USA sehen ihre langjährige Rolle als eindeutiger Hegemon durch den Aufstieg Chinas bedroht, auch wenn sie und ihre langjährigen Verbündeten (der „Westen“) noch immer in vielen Bereichen eindeutig dominieren (Wolf 2019). Fehlverhalten relativ zu globalen Regeln ist zweifellos bei vielen Akteuren vorhanden. Anerkenntnis dieser sollte jedoch zu regelkonformem Verhalten, sowie zu Reformen der global vereinbaren Regeln führen, anstatt zu einseitigen und aggressiven Aktivitäten. Angesichts der globalen Krisen im sozialen und Umweltbereich ist stärkere Kooperation und nicht Konfrontation und Abschottung vonnöten (Bayer 2019).
Wege für die Zukunft
Wie oben argumentiert, handelt es sich bei der derzeitigen Wachstumsabschwächung weniger um ein „normales“ Konjunkturmuster, sondern um ein strukturelles Problem mit dem herrschenden System der Weltwirtschaft, welches durch nationalistische Abschottung, Handelskonflikte und Autarkeibestrebungen verstärkt wird. Folgende Fehlentwicklungen müssen prioritär angegangen werden:
– Die Übermacht des Finanzsystems, seine Allgegenwart und Beeinflussung der Unternehmenspolitik und der Wirtschaftspolitik auf nationaler und globaler Ebene muss zugunsten eines der Realwirtschaft dienenden Paradigmas gebrochen werden.
– Raschest muss eine weltweite sichtbare „Mission“ zur Bekämpfung der Umweltkrisen gestartet werden, die alle Bereiche der Wirtschaftspolitik umkrempelt.
– Die immer weitergehende soziale Krise durch Verelendung der Menschen in den armen aber auch weniger armen Ländern, die klaffende Einkommens- und Vermögensverteilung bedroht den sozialen Frieden auf globaler und nationaler Ebene. Diese Ungleichheiten sind nicht allein durch Steuer- und Abgabesysteme zu lösen, sondern nur durch primär bei den Lohnbedingungen, bei der internationalen Konkurrenz, bei den Entlohnungssystemen und deren Akteure.
– Der Finanzbereich muss durch deutlich höhere Eigenkapitalerfordernisse, durch risikoadäquate Hinterlegung von Vermögenswerten, durch Stärkung traditioneller Banken, durch Zurückdrängung von Firmenzusammenschlüssen, aber auch durch Vermeidung von Vermögens- und damit Steuerverschiebungen, durch Steuern auf Finanztransaktionen, und andere Maßnahmen der Wirtschaft und den Konsumenten allein nutzbar gemacht werden.
– Die Wirtschaftspolitik soll sich nicht weiteran der Steigerung des Bruttoinlandsprodukts als Hauptindikator, sondern an der Steigerung und Beibehaltung des Wohlbefindens der Menschen orientieren. Weitere BIP-Steigerungen führen in vielen Bereichen eher zu einer Beeinträchtigung als zur Steigerung der menschlichen Wohlfahrt (Wilkinson-Pickett 2009). Bei allen Maßnahmen sind gleichzeitig soziale, ökologische und ökonomische Interessen zu verfolgen, statt einseitig den (Finanz-)Unternehmen dienende.
– Wirtschafts- und Gesellschaftspoltik braucht viel mehr Mitwirkung der Bevölkerungen, und zwar nicht nur beratend, sondern auch in Entscheidungen. Neue Ansätze über Fokusgruppen, über elektronische Bürgerversammlungen und andere Partizipationsformen sind nötig.
Prognosen über die weitere Entwicklung sind schwierig. Klar ist jedoch, dass ein Weiterbestehen auf den Verwerfungen, welche das bestehende Wirtschafts- und Gesellschaftssystem hervorruft, zu tiefgreifenden Krisen führen wird.
Ein Beispiel für nachhaltige Entwicklung?
Die sozialdemokratisch-progressive Fraktion im EU-Parlament propagiert zurecht das Ziel eines „Nachhaltigen Wohlergehens für Alle“ (Feigl/Hoffmann 2019). Dieses wird mit einem umfassenden Programm (Well-Being 2018) mit Empfehlungen unterlegt und umfasst folgende Bereiche: den Umbau des Kapitalismus; Soziale Gerechtigkeit für Alle; Sozio-ökologischer Fortschritt; Ermöglichung von Reformen und Ermächtigung der Bevölkerung und damit sehr weitreichende Zielsetzungen und Instrumente. Dieses Programm ist zwar für die Europäische Union intendiert, kann jedoch weitgehend für die Weltgesellschaft als leitend gesehen werden, auch wenn im Weltmaßstab die Ungleichheit der Einkommen und Lebensbedingungen weit größer ist als innerhalb der EU. Durch die Fokussierung der Studie auf „Gleichheit“, bzw. Abbau von Ungleichheiten als Hauptziel wird jedoch die ökologische Dimension eher unterbelichtet behandelt. Abbau von Ungleichgewichten ist natürlich eine wichtig, doch übersieht diese Priorisierung, dass es vorrangig, darum gehen muss, die allgemeine Quantität von ökologischen Beeinträchtigungen einzudämmen. Der Ausstoß von Treibhausgasen, der damit verursachte Klimawandel, der Raubbau an Wasser mit seinen Auswirkungen auf die Meere, der Verlust von Artenvielfalt, und anderes mehr sind so weit fortgeschritten, dass sie insgesamt das Wohlergehen der Menschheit bedrohen – wenn auch in regional und sozial unterschiedlichem Ausmaß. Daher müssen Anstrengungen unternommen werden, die gesamte Menge an Abbau von „Umweltkapital“ zu senken, um ein Überleben des Planeten und seiner Menschheit zu sichern.
Richtig ist in diesem Bericht, dass soziale, wirtschaftliche und ökologische Zielsetzungen eng miteinander verbunden sind und daher gesamthafte Strategien zur Sicherung aller drei Bereiche notwendig sind. Woran es dem Bericht und seinen Vorschlägen mangelt, ist, wie mit den zwischen diesen Zielsetzungen vielfach auftretenden Konflikten umzugehen ist, etwa mit der gewünschten Zahl der Steigerung von gesunden Arbeitsplätzen und dem vielfach damit verbundenen Ausstoss von Emissionen; oder mit dem Wunsch der Erhaltung von natürlichen Habitats und den ökonomischen Interessen, meist profitgetrieben, von Wirtschaftsunternehmen. Auch wird die Rolle der dominierenden Finanzmärkte nur unzureichend angesprochen.
Bayer, K. (2018). Disruption in Global Economic Governance – Risse in der internationalen Wirtschaftsordnung, https://wordpress.com/post/kurtbayer.wordpress.com/2385, 29.11.2018
Bayer, K. (2019). Ändert die Wirtschaftspolitik! Der Standard, 25.Januar 2019
Brennan, L. Corporations must rethink capitalism to heal society‘s wounds. Financial Times, Jan. 30, 2019
Feigl,G., Hoffmann,U. Europa 2030 (2019): Nachhaltiges Wohlergehen für Alle? Arbeiterkammer Wien, https://awblog.at/nachhaltiges-wohlergehen-fuer-alle/
Piketty, Th.Capital in the Twenty-First Century. Cambridge, Mass. 2014
Rasmus, Jack. Global Economy on the Bring as Davos Crowd Parties On, (2019) https://www.globalresearch.ca/global-economy-bringk-davos-croed-parties/5666277
Well-Being for Everyone in a Sustainable Europe (2018), Report of the Independent Commission for Sustainable Equality | 2019-2024 Brussels, November 2018; https://www.progressivesociety.eu/sites/default/files/2018-12/S%26D_ProgressiveSociety-SustainableEquality_BROCHURE_V18_spreadsWEBSITE.pdf
28, 2019W
Wilkinson, R., Pickett K. (2009). The Spirit Level. Why Equality is Better for Everyone. Penguin Books, London
World Economic Outook (WEO 2019).
https:/www.imf.org/en/Publications/WEO/Iissues/2019/01/11/weo-update-january-2019
Wolf, M. The challenge of one world, two systems. Financial Times, Jan. 30, 2019