Bericht über 10 „ganz normale“ Tage in Londons Opernhäusern und Konzerthallen: zuerst eine wundervolle Zauberflöte in der Regie von David McVicar von vor 10 Jahren, aufgefrischt von Lee Blakeley, die sich offenbar zum Teil an Ingmar Bergman’s Opernfilm für Kinder bedient: die Drei Knaben kommen in einem Luftfahrzeug a la Seifenkiste daher, die Schlange ist märchenhaft riesengroß, die Königin der Nacht zürst als treusorgende Mutter, dann als rachesüchtiges Monster (warum: geht es nur um Macht?) dargestellt. Sarastro ist nicht als Hohepriester, sondern eher als aufgeklärter Monarch dargestellt–nicht ganz logisch, da dabei die Gemeinschaft seiner Guten Männer nicht als klösterlich erkennbar ist – was sind sie also? Er orgelt recht ordentlich, die stimmliche Sensation aber ist Kate Royal als Pamina, die unglaublich seelenvoll, zart und opferbereit ihre Partie absolviert und Tamino – Joseph Kaiser -, Papageno und Papagena – alle weit mehr als nur ordentlich- überstrahlt. Es gelingt der Inszenierung und dem sehr einfühlsam spielenden Orchester bestens, die Macht der Musik (via Taminos Zauberflöte und Papagenos Glockenspiel), die Prüfungen und Fährnisse des Lebens zu überwinden, darzustellen. Eine der eindrucksvollsten Zauberflöten, die ich je gesehen habe.
Dann zwei als sensationell klassifizierte, vollkommen ausverkaufte Klavierabende: zuerst Evgeni Kissin mit einem Liszt-Programm, dann Maurizio Pollini (den ich zum ersten Mal vor 40 Jahren in Wien gehört habe) mit Beethoven. Kissin war eine einzige Enttäuschung für mich: natürlich ist er brilliant, technisch hervorragend – aber er schien an diesem Abend seine Musikalität nur vorzutäuschen: hämmerte in den Steinway, dass ich Angst um den Flügel hatte, brachte ungeheuer zarte Pianissimi, aber das Ganze wirkte inkonsistent und unauthentisch, eher gegen die Musik als mit ihr. Die roboterhafte Starrheit seines Auftritts, durchbrochen nur schlußendlich durch ein kleines angedeutetes Lächeln nach mehreren Minuten standing ovations, ließ eher ein psychisches oder Tagesverfassungsproblem vermuten als den gefeierten Pianisten. Dem Jubel im Barbican Center zu schliessen, war ich allerdings in meiner Einschätzung in der Minderheit. Dennoch eine Enttäuschung. Ganz anders dagegen Maurizio Pollini, der eine Klarheit der Beethovensonaten mit ungeheurer Musikalität verband und vorzeigte, wie das geht: ohne Allüren, etwas steif in der Körperhaltung, aber voll konzentriert und die Musik durchdringend: besser kann man Beethoven nicht spielen. Diesmal war ich mit der enthusiastischen Mehrheit. Pollini spielte die drei späten Sonaten in einem durch, ohne Pause und liess sich auch durch minutenlange Standing Ovations zu keinem dacapo hinreissen – ein erhebendes Erlebnis.
Zwei Tage später ein ungeheuer dynamisches Brahms-Violinkonzert mit Janine Jansen, technisch hervorragend, dynamisch und auch seelenvoll. Die Begleitung durch das London Symphony Orchestra übertönte zwar ab und zu die Solistin, trotz deren vollem Körper- und Instrumenteneinsatz, war aber ein kongenialer Partner.
Dann die als Sensationserlebnis angekündigte zeitgenössische Oper von Mark-Anthony Turnage über die hinterwäldlerische Texas-Fastfood-Kellnerin, die von den Wundern der „großen Stadt“ (Houston!!!) träumt, dort Stripperin, Lap-Dancer mit unendlich vergrößerten Silikonbrüsten, und letztlich Ehefrau eines um 60 jahre älteren Milliardärs wird, der sie mit Geschenken für ihre Dienste überhäuft, die aber als verlierende Erbstreiterin und letztlich Drogentote endet, mit einem Wort Anna Nicole (Smith), wiederum in Covent Garden. Diese „from rags-to-riches“ Geschichte eines feuchten und böse endenden amerikanischen Traums taucht die ehrwürdige Covent Garden Oper in ein einziges Anna-Nicole-Spektakel mit Porträts der echten Anna-Nicole Smith in allen Gängen, einem pinkfarbenen eisernen Vorhang, etc., etc. – gerade so als ob Covent Garden der Welt zeigen möchte, daß es nicht nur Fidelio und Liebestrank sich aufzuführen traut, sondern auch die Fäkalsprache des – in seinem an Wortdurchfall leidenden, an Schikaneder erinnernden- Librettos von Richard Thomas. Dieses ist die große Schwäche dieser Oper, da es sich in einer Aneinanderreihung an amerikanischen Unterschichtslangs und Walmart, McDonalds- und Kreme-Doughnut, gewürzt mit mehr Fourletter-Words als man für möglich hält, erschöpft. Diesem unablässigen Verbalausstoß wird die Charakterisierung und Motivation der Personenführung geopfert. Dennoch: die Musik ist interessant, mit Jazzelementen versehen und versucht verzweifelt, dem engen Korsett des Gebrabbels zu entkommen, nur teilweise mit Erfolg. Hervorragend die Sänger, allen voran die Protagonistin Eva-Maria Westbrök, die sowohl stimmlich als auch darstellerisch den Aufstieg und Fall der Anna-Nicole perfekt darbietet, wie auch ihr Zweiter Ehemann, der Milliardär Howard Marschall II, Alan Oke, ihr sie letztlich in den Abgrund reißender Rechtsanwalt und Gelibeter Howard Stern (Gerald Finley) und die unsägliche Familie. Grandios die Inszenierung in einer Mischung aus Griechischem Chor auf der Bühne, Las Vegas und Disneyland, exakt das Milieu, aus dem Anna Nicole kommt, nachzeichnend. Daher, trotz schwacher Personenzeichnung wegen des Librettos, eine Geschichte, die sich mit jener Mimis oder Lulus durchaus messen kann – in einer überzeichneten unsäglich kommerzialisierten Konsumwelt von heute.
Als Gegenstück dazu Wagner’s Parsifal in der English National Opera in der 12 Jahre alten sehr freien und eindrucksvollen Inszenierung von Nikolaus Lehnhoff: optisch weitgehend entkleidet aller christlichen Mystik, die aber in Text und Musik natürlich die überragende Rolle spielt, wird es weniger als Kampf zwischen Christentum und (arabischem) Heidentum dargestellt, denn als menschliche Tragödie von Verfehlung und – letztlich – Erlösung durch einen „reinen, guten Menschen“. Die Gralsritter erinnern in ihren Auftritten an die chinesischen Tonritterbrigaden in staubigen Tarnuniformen aus dem 1. Weltkrieg, Klingsors Schloß ist eine projezierte Fotografie eines Beckenskeletts – von mir als Anspielung auf den Platz der Amfortas-Wunde, die ja auch an der Stelle ist, die Jesus am Kreuz als Speerwunde erhalten hat, der Gral wird durch eine wundervolle Lichtregie dargestellt, dem eine an die Kaaba in Mekka erinnernde Steinskulptur sich drehend weichen muß, die Blumenmädchen sind – wie die gesamte Choreographie – eindrucksvoll verwirrt in ihren Tänzen. Die große Überraschung ist jedoch Lehnhoffs Schluß, der nicht mit Kundrys erwünschtem Tod und Parsifal als König der Gralsritter endet, sondern damit, daß Parsifl die ihm von Gurnemanz aufgesetzte Krone dem totel Titurel auf die Brust legt, die Gralsritter ihrem eigenen Schicksal überläßt und mit Kundry – geläutert und getauft – auf einem Eisenbahngleis (ruft in mir die Erinnerung an die Gleise nach Auschwitz hervor) in die Dunkelheit entschwindet. Auch hier wieder dominiert in dieser Inszenierung das Menschliche das Christliche in Wagner’s Partitur. Sängerisch ist vor allem John Tomlinson’s Gurnemanz phänomenal, sowohl in Diktion als in stimmlicher Präsenz in dieser Monsterrolle. Iain Paterson’s Amfortas ist beeindruckend, torkelt ein bißchen zu sehr auf der Bühne herum; Stuart Skelton als Parsifal zeigt vor allem im 3. Akt seine Heldentenorqualitäten, leider hat er die Figur eines Johan Botha und dessen darstellerisches Können; Kundry (Jane Dutton) kommt mit den Männern stimmlich nicht ganz mit, obwohl sie vor allem im 2. und 3. Akt berührend singt. Sehr eindrucksvoll das Orchester unter der Leitung von Mark Wigglesworth, dem eine äußerst eindrucksvolle Tongebung gelingt, die den Stimmen viel Raum läßt und vor allem in den Vorspielen die Grandiosität der Wagnerschen Musik blitzen läßt. Einem deutschsprachigen Besucher fällt auf, daß in der englischen Übersetzung (in der English National Opera wird alles fast ausschließlich auf Englisch gesungen) viel von der eigentümlichen Sprache Wagners verlorengeht. Dennoch: ein sehr sehr denkwürdiger Abend.


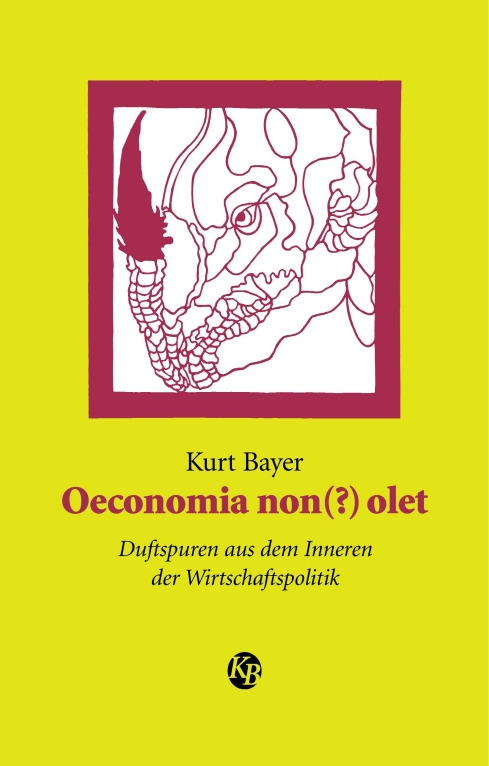



Deine Interpretationen sind großartig. Bewunderswert sind besonders deine persönlichen Einschätzungen, was musikalische Darbietungen, Schwächen des Librettos und darstellerische Leistungen betrifft.
Eine ganz kleine Bemerkung: im Deutschen braucht es keinen Apostroph im Genitiv.